Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
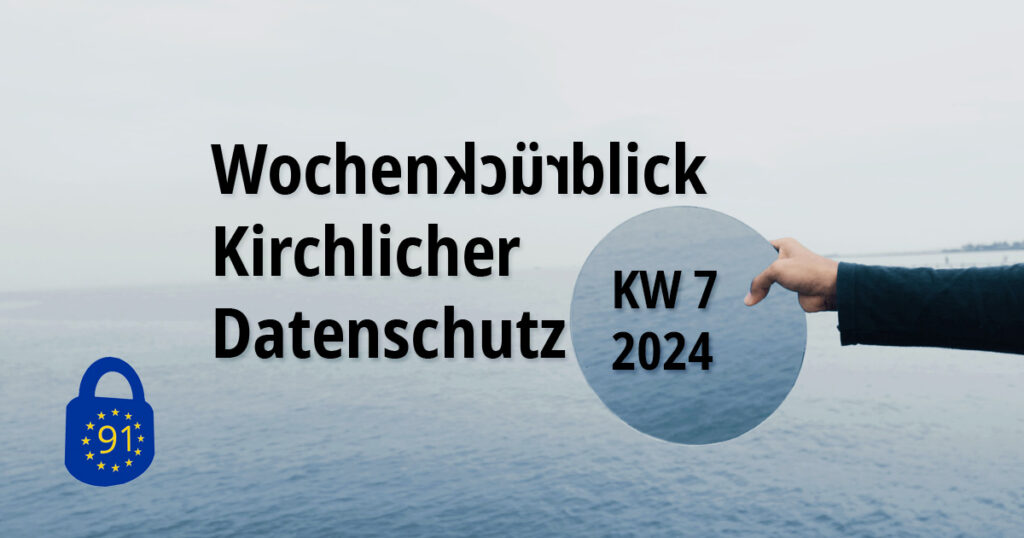

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
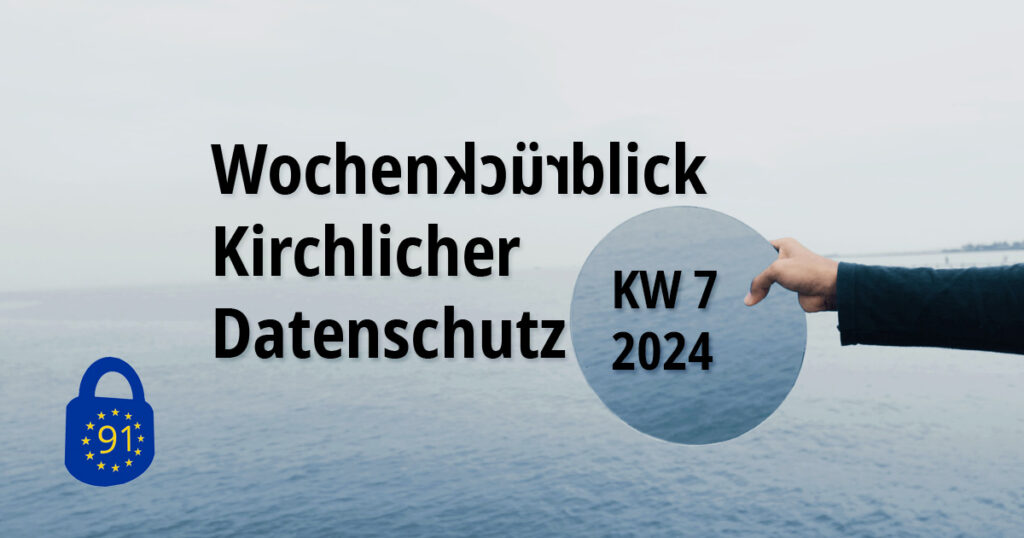
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
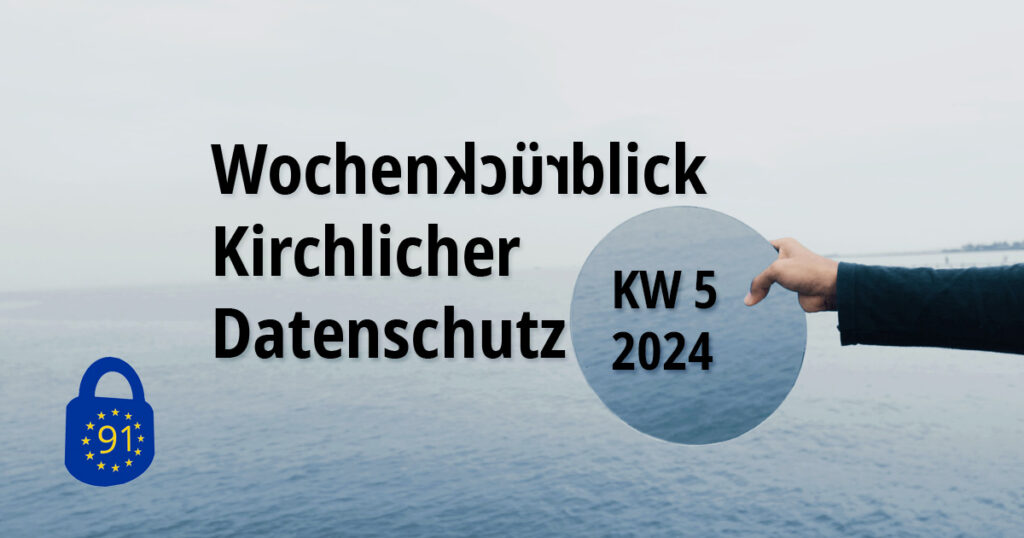
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Das katholische Datenschutzzentrum Dortmund gibt Winke dazu, ob und wie Microsoft 365 eingesetzt werden kann – allerdings ohne Patentlösungen: »Damit Microsoft die Daten nicht mehr zu eigenen Zwecken verarbeiten kann, müsste der Zugriff auf die personenbezogenen Daten vom Verantwortlichen unterbunden werden. Neben der Nutzung pseudonymisierter Nutzerkonten könnte auch die Nutzung des Cloud-Speichers ausgeschlossen werden«, heißt es in dem Beitrag. Der Einzelfall sei zu betrachten und in einer Datenschutzfolgenabschätzung zu prüfen. Die katholische NRW-Aufsicht geht damit in eine ähnliche Richtung wie die bayerische, aber mit weniger konkreten Ansagen.
Nach dem Erfolg gegen die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche hat die niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte eine weitere Religionsgemeinschaft im Visier: Auf Anfrage teilte die LfD Niedersachsen mit, dass ein weiteres Prüfverfahren gegen eine Freikirche gemeinsam mit einer weiteren Aufsichtsbehörde derzeit vorbereitet wird. Weitere Angaben können angesichts des frühen Vorbereitungsstadiums noch nicht gemacht werden, so der Sprecher. Mit Blick auf das Urteil des VG Hannover, mit dem das Datenschutzrecht der SELK verworfen wurde, zeigte sich die Aufsicht zufrieden. »Aus Sicht unserer Behörde ist es sehr zu begrüßen, dass eine Vielzahl an wichtigen Auslegungsfragen zu Art. 91 DS-GVO nun erstmals gerichtlich entschieden wurde. Wir gehen davon aus, dass dieses Urteil über den konkreten Einzelfall hinaus auch für andere (Frei-)Kirchen oder Religionsgemeinschaften Bedeutung haben könnte«, so der Sprecher. Mit Blick auf die durch die SELK eingelegte Berufung beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht bleibe jedoch zunächst noch die weitere Entwicklung der Rechtsprechung abzuwarten.
In Berlin, wo die Landesdatenschutzbeauftragte die Zeugen Jehovas prüft, gibt es unterdessen noch nichts Neues – auf Anfrage teilte ein Sprecher mit, dass man hoffe, im ersten Quartal fertig zu sein. »In den kommenden Wochen stehen dazu weitere Abstimmungen mit anderen Aufsichtsbehörden und den zuständigen Gremien der Datenschutzkonferenz an«, so der Sprecher.
Auf Mastodon beantwortet der BayLfD jede Woche eine Frage – dieses Mal geht es um Religionsunterricht: »Dürfen kirchliche Religionslehrkräfte, die an staatlichen Schulen eingesetzt werden, Daten von Schülern auf IT-Systemen einer kirchlichen Stelle speichern?« Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach sei in der Verantwortung der Schule, antwortet die Aufsicht. »Der Umgang mit Schülerdaten ist grundsätzlich der Schule als verantwortlicher Stelle zuzurechnen; maßgeblich sind die dort geltenden Datenschutzregeln. Eine Nutzung kirchlicher IT-Infrastruktur ist jedenfalls nicht ohne weiteres zulässig.«
In der Neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA 1/2023, S. 7–13) befasst sich Thomas Ritter mit Compliance-Pflichten bei der Leitung katholischer Unternehmen, die sich aus der neuen Grundordnung des kirchlichen Dienstes ergeben. Mit der neuen Grundordnung hat das Kriterium der Kirchenzugehörigkeit für weniger Beschäftigte Relevanz (nicht aber des Kirchenaustritts). Damit stellt sich die Frage, ob die Religionszugehörigkeit über die Steuer hinaus überhaupt noch in den Personaldaten verarbeitet werden kann. Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche wird nur noch gefordert von Beschäftigten, denen eine besondere Verantwortung für die katholische Identität der Einrichtung zukommt, und im pastoralen Dienst. Das führt dazu – so Ritter überzeugend –, dass bei solchen Stellen auch die Frage nach dem Bekenntnis im Bewerbungsverfahren zulässig ist. Eine falsche Antwort begründe das Recht der Anfechtung. »Es besteht ein berechtigtes Interesse der Kirche und der ihr zuzurechnenden Träger von kirchlichen Einrichtungen an einer wahrheitsgemäßen Beantwortung«, so Ritter. Dabei spreche im Blick auf den institutionellen Ansatz der neuen GO viel dafür, dass die Frage nach der Religionszugehörigkeit – etwa im Personalfragebogen – bei anderen (potentiellen) Beschäftigten zulässig sei.
Seit knapp anderthalb Jahren gibt es das Kirchliche Datenschutzmodell: Die katholischen und evangelischen Datenschutzaufsichten haben das Standard-Datenschutzmodell für die kirchlichen Gesetze KDG und DSG-EKD adaptiert, um im Bereich der Kirchen auf bewährte Methoden zum Datenschutzmanagement zurückgreifen zu können. Auf einer eigenen Webseite findet sich mittlerweile neben dem Modell auch Schulungsmaterial – doch auch damit bleibt das KDM komplex.

Im Interview berichten Boris Reibach und Maria Schumacher, beide auf Datenschutz spezialisierte Rechtsanwält*innen, von ihren Praxiserfahrungen aus anderthalb Jahren Arbeit mit dem KDM – und wie kleinere Vereine und Organisationen ihren Datenschutz gestalten können, ohne gleich ein umfangreiches Datenschutzmodell einzuführen.
WeiterlesenAm Freitag hat das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zum ersten Mal in mündlicher Verhandlung getagt. Zu verhandeln waren die Rechtsmittel, die gegen den Beschluss zur Visitation der Münchener Katholischen Integrierten Gemeinde (KIG) eingelegt wurden. (Erste Instanz: IDSG 03/2020 vom 9. Dezember 2021.) Wesentliche Streitpunkte dabei: Stellt die Weitergabe eines Zwischenberichts der Visitator*innen einen Datenschutzverstoß dar, und wem wäre der zuzurechnen – den Visitator*innen selbst oder dem Erzbistum in Gestalt des Münchner Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx?
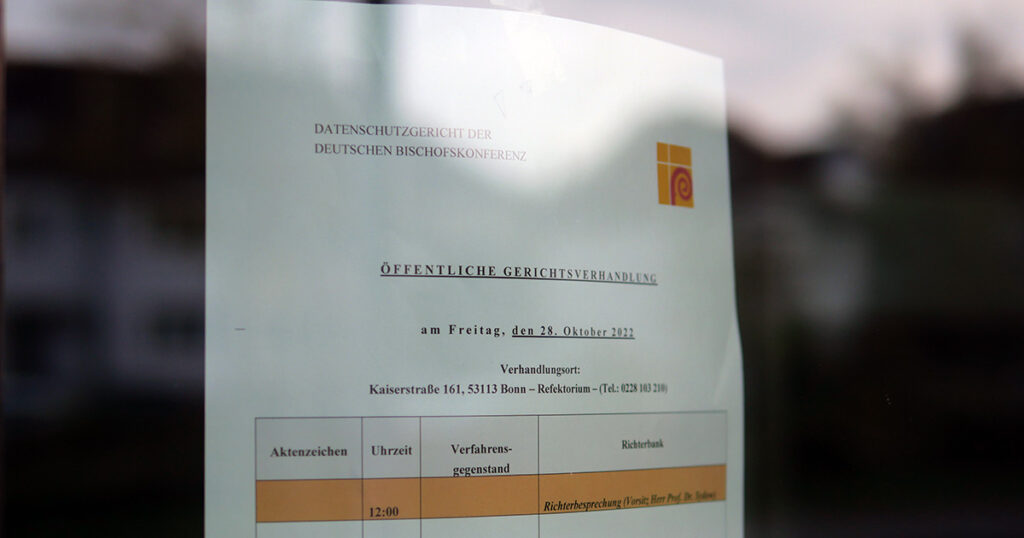
Eigentlich sieht die Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung wenig Transparenz vor: Keine Pflicht zur Veröffentlichung von Beschlüssen, und erst recht keine Öffentlichkeit der Verhandlungen. Umso mehr spricht es für das Gericht, dass es weit transparenter als vorgeschrieben arbeitet. Wenn auch recht kurzfristig angekündigt (öffentlich auf der Webseite des Gerichts in derselben Woche wie die Verhandlung), so war die Verhandlung doch öffentlich.
WeiterlesenAbonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
In Polen geht die Kontroverse um die Vernichtung von Akten in kirchlichen Missbrauchsverfahren weiter. Während die staatliche Missbrauchskommission weiterhin darüber klagt, dass Akten des bischöflichen Geheimarchivs entsprechend der kirchenrechtlichen Regeln nach dem Tod des Angeklagten oder zehn Jahre nach der Verurteilung vernichtet werden und so eine Aufarbeitung erschwert ist, sieht die Polnische Bischofskonferenz keine Probleme mit der Praxis und sieht im Zusammenspiel von polnischer Justiz und Heiligem Stuhl die Regierung am Zug, angemessene Vereinbarungen und gesetzliche Grundlagen zu schaffen.
Wolfgang Huber wagt den großen Aufschlag und hat eine »Ethik der Digitalisierung« unter dem Titel »Menschen, Götter und Maschinen«(Affiliate link) vorgelegt. Der ehemalige Berliner Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende befasst sich darin natürlich auch mit Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung. Die Überschrift des vierten Kapitels, »Grenzüberschreitungen«, ist dabei programmatisch: Es wird ein grundsätzlich pessimistisches Bild gezeichnet, eine »Erosion des Privaten« festgestellt. Huber schlägt mit Hans Jonas eine »Heuristik der Furcht« als ethische Regel zum Umgang mit den eigenen Daten vor: »Es ist ein Gebot der Selbstachtung, Anbieter mit transparentem Datenschutz zu bevorzugen, Suchanfragen auf das Notwendige zu beschränken und Informationen über sich selbst nicht leichtfertig preiszugeben.« Dazu brauche es Selbstverpflichtungen der Digitalfirmen und eine Verschärfung der internationalen Rechtsregeln für den Umgang mit persönlichen Daten im Netz. Wie solche Regeln gestaltet sein können, fehlt allerdings. Allzu oft bleibt Huber bei einer pessimistischen Diagnose. Daten gibt es nur im gesellschaftlichen Verfallsmodus. Informationelle Selbstbestimmung wird zwar hochgehalten, dabei aber so interpretiert, dass selbstbestimmt nur das ist, was Hubers ethische Reflexionen für gut halten. »Dem digitalen Freiheitsgewinn wird ein erheblicher Teil der persönlichen Freiheit geopfert«, klagt er. Dass persönliche Freiheit auch in digitalem Freiheitsgewinn bestehen kann, ist nicht vorgesehen. Stattdessen wird wieder einmal Jaron Lanier und sein Social-Media-Ausstieg als Goldstandard dargestellt. Die DSGVO wird zwar erwähnt, aber ohne große Kenntnis und analytische Tiefe. Sie verfolge »erkennbar das Ziel, die umfangreiche Nutzung privater Daten mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung vereinbar zu machen und zugleich eine Nutzung dieser Daten in möglichst hohem Umfang zu ermöglichen«. Woran sich das zeige, ist keiner Erläuterung wert. Huber beschränkt sich weitgehend auf die von ihm als zentral ausgemachten Instrumente der Pseudonymisierung und Anonymisierung. »Aus ethischer Perspektive ist es jedoch keineswegs unproblematisch, die Daten einer Person dann als frei verfügbar anzusehen, wenn sie statt unter dem authentischen Herkunftsnamen unter einem Pseudonym genutzt werden«, urteilt Huber. Nur: Wer vertritt diese Position? Die DSGVO jedenfalls nicht. Den Datenschutzdiskurs bringt Huber mangels Substanz so jedenfalls nicht weiter. »Theologisch interessierte Oberstudienräte finden gelehrte Einwände gegen die in den Feuilletons dieser Republik erhobenen Großthesen über die Chancen der Digitalisierung«, schließt die lesenswerte Rezension des Buchs in der Eule.
Noch bis zum 31. August können Vereine auch ohne entsprechende Satzungsregelungen ihre Mitgliederversammlungen digital abhalten – dann läuft die Sonderregelung des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie (GesRuaCOVBekG) aus.

Der Bundesrat hat nun eine Änderung des § 32 BGB vorgeschlagen, um diese Regelung zu verstetigen, die Bundesregierung begrüßt die Änderung – es ist also durchaus wahrscheinlich, dass weiterhin digitale Teilnahme an Mitgliederversammlungen möglich ist. Die Begründung des Gesetzesentwurfs ist bemerkenswert – und unterscheidet sich deutlich von Regelungen, wie sie im kirchlichen Recht zu digitalen Gremiensitzungen zu finden sind: Digitales Tagen wird nicht als defizitär, sondern als Teilhabe ermöglichend verstanden.
WeiterlesenMichael Medla (28) ist Jurist und seit 2021 Diözesanleiter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und des Bischöflichen Jugendamtes im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Im Diözesanverband ist er unter anderem für das Thema Digitalisierung zuständig. Im Interview berichtet er davon, welchen Stellenwert Datenschutz in der Jugendarbeit hat und wie die Jugendarbeit in Rottenburg-Stuttgart mit einer eigenen Cloud unabhängig von großen Konzernen und kostenlosen, aber wenig datenschutzfreundlichen Tools werden will. Der Start ist schon für dieses Jahr nach der Sommerpause geplant.

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Die Datenschutzkonferenz hat auf ihrer jüngsten Sitzung laut Protokoll ein Gutachten mit dem Titel »Rechtliche Möglichkeiten zur Stärkung und Institutionalisierung der Kooperation der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK 2.0)« beraten (eine IFG-Anfrage ist bereits gestellt). Besonderes Engagement, die spezifischen – also auch die kirchlichen – Aufsichtsbehörden besser einzubinden, ist nicht zu erwarten. Aber man lässt sich ja gern überraschen.
Der 50. Tätigkeitsbericht der Hessischen Datenschutzaufsicht ist erschienen. Darin wird wie erstmals im vergangenen Jahr auch die Kategorie »Religionsgemeinschaften« in der Eingabenstatistik aufgeführt. Beschwerden (2) und Beratungen (3) gingen im Vergleich zum Vorjahr deutlich von zuvor insgesamt 23 zurück. Im vergangenen Jahr ging es hauptsächlich um die Zeugen Jehovas und Mormonen, insbesondere mit Blick auf Werbung, Briefe und Datenlöschung bei Austritt, wie die Sprecherin damals mitteilte, die aktuelle Anfrage ist noch nicht beantwortet. Dieses Mal gab es außerdem Weisheit aus dem Aufsichtsalltag: »Datenschutzrechtliche Beschwerden entstammen dem prallen Leben und ihre Bearbeitung erfordert neben datenschutzrechtlichem Sachverstand oft auch Humor, Empathie oder auch die Beschäftigung mit Websites, die ansonsten von dienstlichen Rechnern nicht aufgerufen werden sollten.«
Die Normen zur Einsichtnahme in Personalakten zur Missbrauchsaufarbeitung tröpfeln immer noch ein – nun hat das Bistum Passau das Gesetz in Kraft gesetzt, nach meiner Statistik die 16. Diözese.
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Am 24. Mai feierten die kirchlichen Datenschutzgesetze seinen vierten Geburtstag. Aus diesem Anlass hat webtvcampus mit der betrieblichen Datenschutzbeauftragten des Diözesancaritasverbands Köln Anna Keller gesprochen. »Die Menschen sind viel sensibler im Umgang mit ihren Daten geworden«, ist ihre Beobachtung – das merke man an der gestiegenen Zahl der Auskunftsersuchen, aber auch am Verhalten von Beschäftigten. Wie’s zur DSGVO überhaupt kam, zeigt der Dokumentarfilm »Democracy – Im Rausch der Daten«. Den gibt’s kostenlos bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu sehen.
In der Katholikentagswoche passierte im kirchlichen Datenschutz sonst wenig – wie auch: Die Konferenz der Diözesandatenschutzbeauftragten lädt in Stuttgart auf der Bistumsmeile ein und ist somit beschäftigt – nächste Woche mehr dazu, was dort die Themen waren.
In eigener Sache: Am 2. Juni gibt es von mir in der Fortbildungsreihe für Öffentlichkeitsarbeit im Jugendverband, die das Jugendhaus Düsseldorf zusammen mit dem BDKJ veranstaltet, einen Workshop zu Datenschutz im Jugendverband. Die Anmeldung zu der digitalen Veranstaltung (10 Euro) ist bis zum 31. Mai möglich.