Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
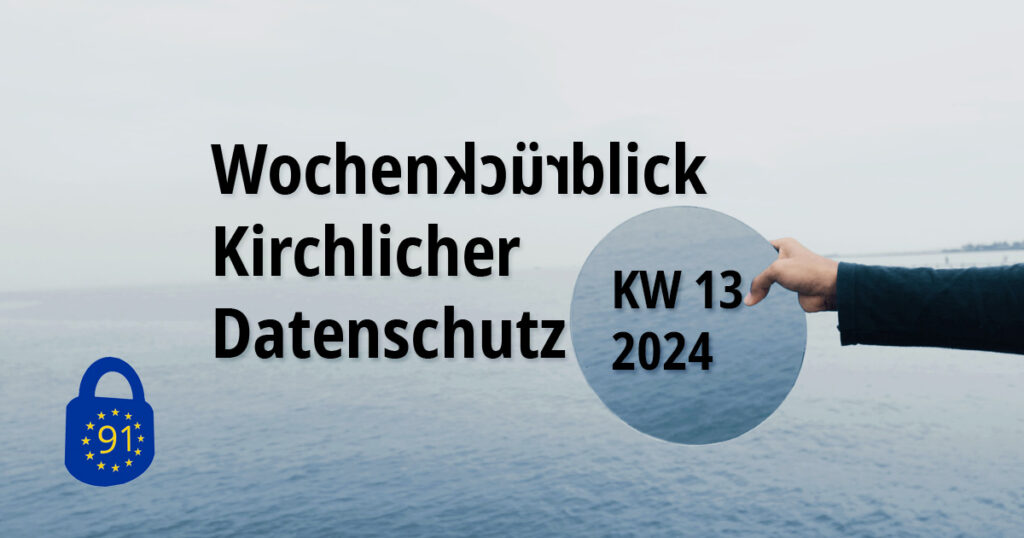

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
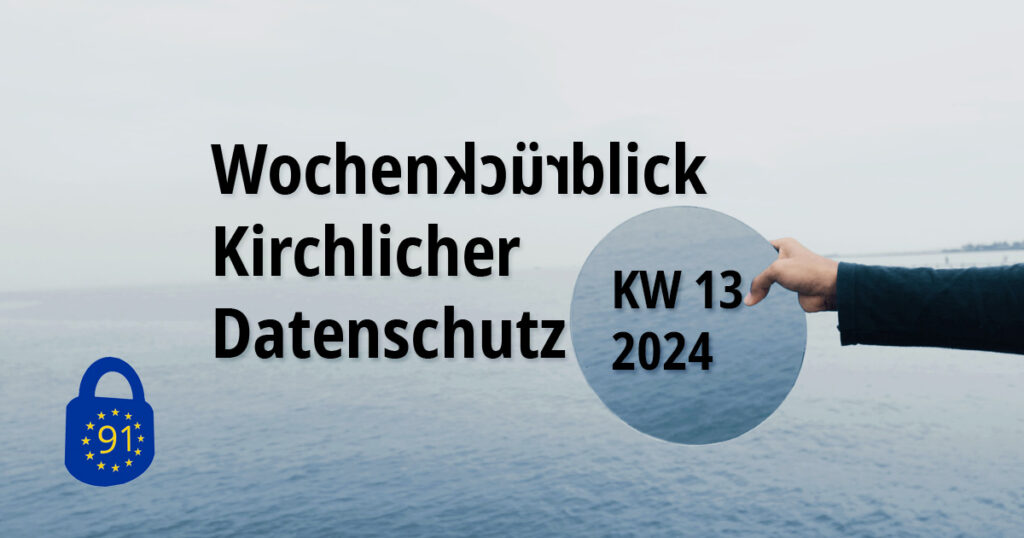
Das katholische Datenschutzrecht ist Kirchenrecht: Das KDG wird jeweils vom Diözesanbischof erlassen, die KDR-OG von den zuständigen Instanzen der Orden, die Gerichtsordnung KDSGO von der Deutschen Bischofskonferenz mit einem besonderen Mandat des Heiligen Stuhls. Da liegt es eigentlich nahe, dass dieses spezielle Kirchenrecht durch Regelungen des universalen Kirchenrechts ergänzt wird wo nötig. In der vergangenen Woche veröffentlichte das IDSG eine Entscheidung, in der es genau das nicht getan hat: Obwohl es eigene Normen des Kirchenrechts zur Fristberechnung gibt, wurden Fristen stattdessen gemäß BGB berechnet.
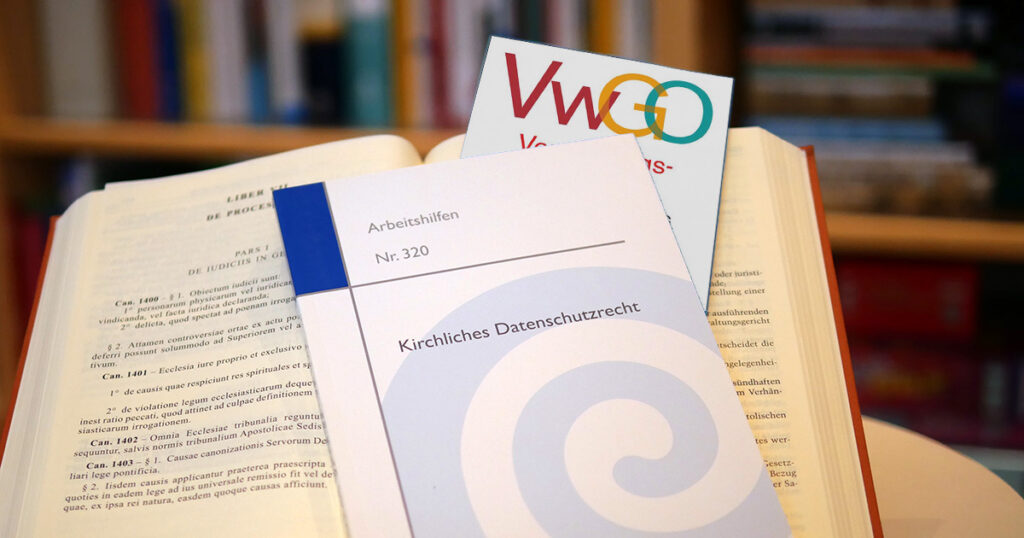
Warum das Gericht so agiert, wird mit einer nun veröffentlichten Entscheidung des DSG-DBK (Beschluss vom 16. Januar 2024, DSG-DBK 02/2023) deutlich: Beide Instanzen gehen davon aus, dass die sehr kompakte kirchliche Gerichtsordnung subsidiär nicht durch das kirchliche, sondern das staatliche Prozessrecht ergänzt wird.
WeiterlesenAbonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
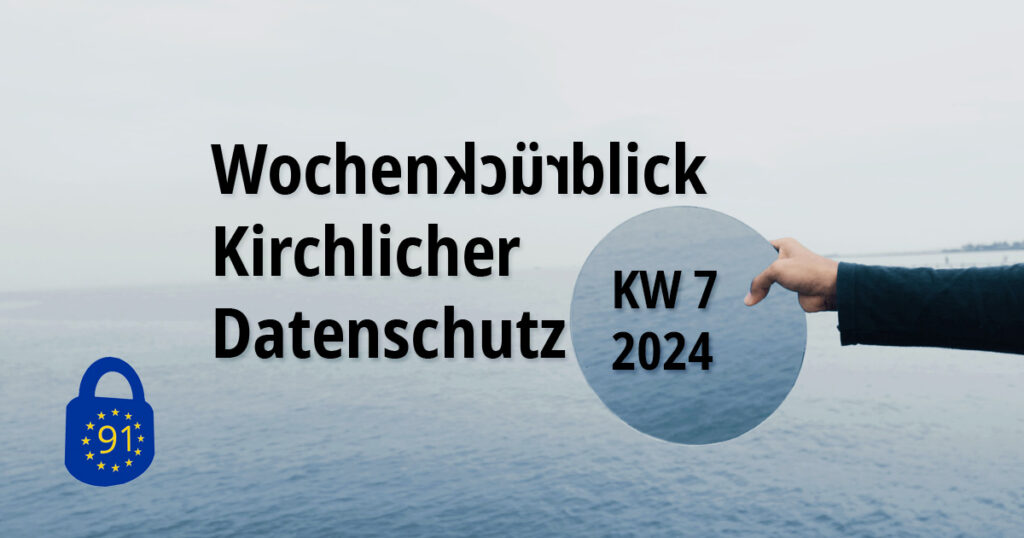
Einige Zeit war Ruhe bei den kirchlichen Datenschutzgerichten. Jetzt wurden gleich vier Entscheidungen des IDSG auf einen Schlag veröffentlicht. Weiterhin gibt es klare Tendenzen, was eigentlich vor Gericht kommt: Streitträchtig sind Beschäftigungsverhältnisse, Sorgerechtsfragen und der Gesundheitsbereich – und Kombinationen davon.
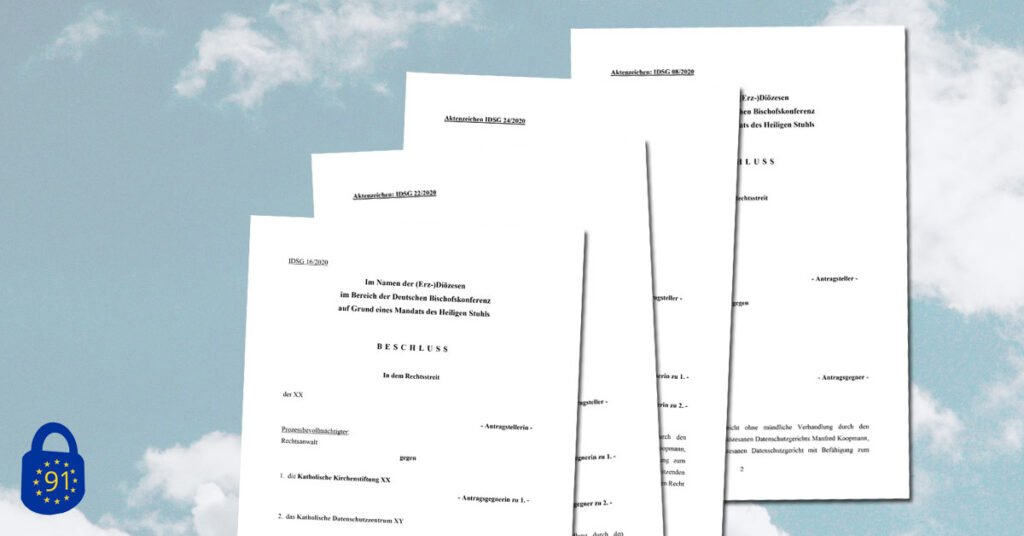
Nachdem nun über 30 Entscheidungen bekannt sind, sind die großen Linien des Gerichts klar, Fragen nach Zuständigkeit, Befugnissen und wem eigentlich Datenschutzverstöße zuzuordnen sind, wird mit großer Konstanz entschieden. Zugleich fehlt es immer noch an Entscheidungen, die die großen Rätsel des kirchlichen Datenschutzes – wann braucht eine Einwilligung keine Schriftform, was ist kirchliches Interesse, wie funktioniert gesetzesübergreifende gemeinsame Verantwortlichkeit – klären. Immerhin: Eine in KDG wie DSGVO wenig genutzte Rechtsgrundlage spielt in dieser Runde eine Rolle.
WeiterlesenAbonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
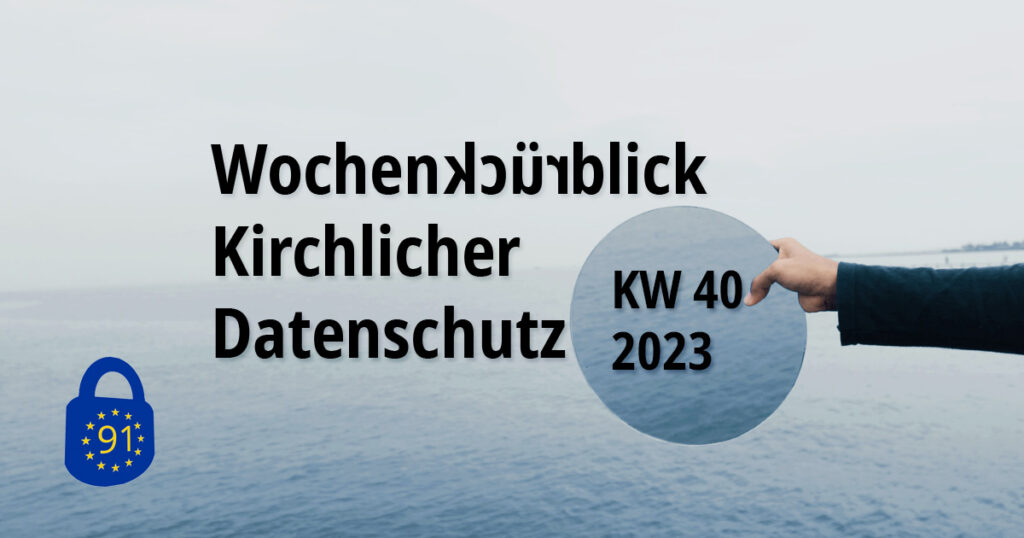
Die Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung ist bislang nur sehr knapp kommentiert. In Sydows KDG-Kommentar findet sich eine kaum zehnseitige von Ulrich Rhode besorgte Einführung, die zudem noch auf recht wenig Entscheidungen der kirchlichen Datenschutzgerichte zurückgreifen konnte. Diese Lücke schließt nun der neue Kommentar von Hermann Reichold, Thomas Ritter und Christian GohmAffiliate link, der die KDSGO neben der Mitarbeitervertretungsordnung und der Kirchlichen Arbeitsgerichtsordnung kommentiert.
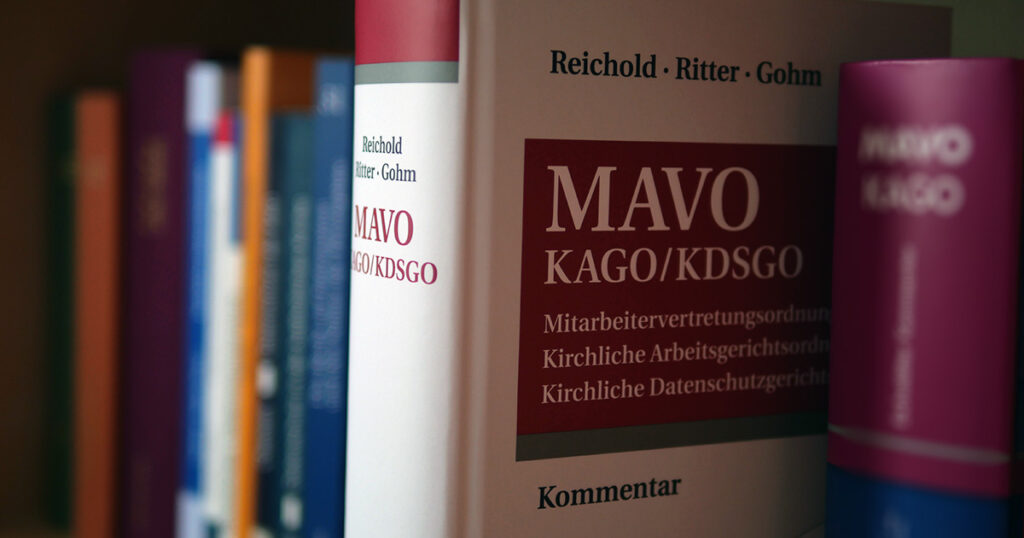
Die Zusammenstellung wirkt auf den ersten Blick etwas wunderlich, vor allem das Nebeneinander von KAGO- und KDSGO-Kommentar ist allerdings hilfreich, und beschweren sollte man sich ohnehin nicht, wenn diese wichtige Materie Huckepack mitkommentiert wird, wo es wohl für einen Stand-alone-Kommentar nur einen zu kleinen Markt geben würde. Trotz Kinderkrankheiten: Der erste ausführliche KDSGO-Kommentar schließt eine große Lücke.
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
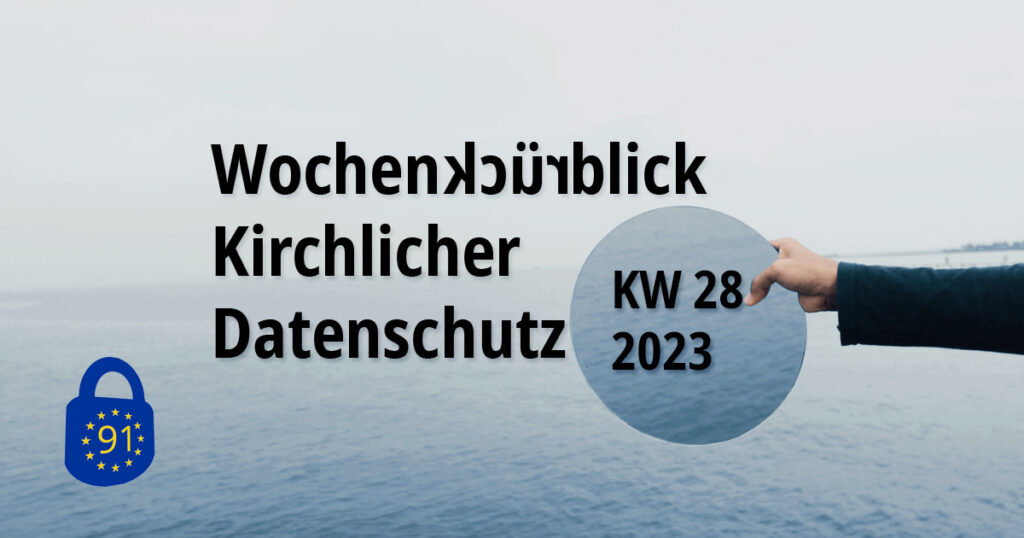
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
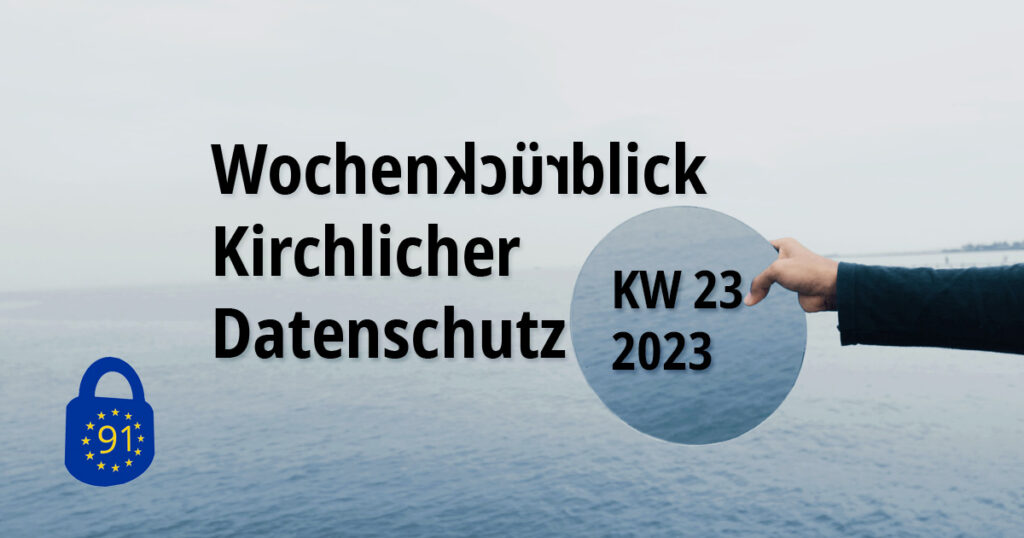
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Das Datenschutzgericht der DBK liefert: Gleich zwei Entscheidungen wurden in dieser Woche veröffentlicht – wenn auch nicht die mit Spannung erwartete zum Streit zwischen dem Erzbistum München und Freising und der Integrierten Gemeinde. In der ersten Entscheidung stellt das DSG-DBK fest, dass Löschen für das Gericht keine Verarbeitung ist: In seiner Entscheidung DSG-DBK 04/2022 (Beschluss vom 3. Januar 2023) hat es die Feststellung eines Datenschutzverstoßes durch den IDSG im Fall einer gelöschten Beistandsakte verworfen. Die erste Instanz hatte alle Anträge des Klägers abgewiesen und nur diese Datenschutzverletzung durch Löschung festgestellt. Die zweite Instanz nimmt zwar auch an, dass die Vernichtung rechtswidrig war – aber aus anderen Gründen als dem Datenschutzrecht. Es gehöre gerade aber nicht zu den Aufgaben der kirchlichen Datenschutzgerichtsbarkeit, jenseits der Abwehr von Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht von Betroffenen auf deren Antrag hin eine allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle des Handelns von Datenverarbeitern vorzunehmen, stellt das DSG-DBK fest (Rn. 19). Was das Gericht über die datenschutzrechtlichen Aspekte entschieden hat, ist interessant: »Das Recht des Antragstellers auf informationelle Selbstbestimmung, dessen Schutz das Datenschutzrecht nach § 1 KDG dient, kann durch eine Löschung von über ihn gespeicherten Daten nicht verletzt sein, weil durch Löschung der datenschutzrechtlich rechtfertigungsbedürftige Persönlichkeitseingriff ja gerade beendet wird.« (Rn. 19) Das kann man durchaus kritisch diskutieren: Auch Löschen ist eine Verarbeitung gemäß § 4 Nr. 3 KDG und bedarf damit einer Rechtsgrundlage – die hier anscheinend fehlte. So argumentierte noch die Vorinstanz (IDSG 10/2021, Rn. 32). Als Gedankenexperiment: Wenn ein online gespeichertes Tagebuch durch den Provider gelöscht wird: Ist das nur eine Verletzung des Hosting-Vertrags – oder greift das in die informationelle Selbstbestimmung ein?
Auch im zweiten DSG-DBK-Beschluss der Woche wurde die erste Instanz bestätigt: Weiterhin ist die Weitergabe von Korrespondenz innerhalb einer Behörde rechtens. (DSG-DBK 03/2021, Beschluss vom 23. Februar 2022.) Die erste Instanz wurde hier schon ausführlich besprochen: Das IDSG hatte als Rechtsgrundlage der Verarbeitung eine Einwilligung angenommen – eine Rechtsgrundlage, die einige Probleme in solchen Konstellationen aufwirft. Für das DSG-DBK war das kein Problem. Auch hier wird daran festgehalten: »Es handelt sich vielmehr um die vom Antragsteller selbst initiierte und gewünschte Bearbeitung seiner Eingabe, mithin um eine rechtmäßige Datenverarbeitung nach § 6 Abs. 1 lit. b) KDG.« Es bleibt also bei der kuriosen Situation, dass ein Betroffener einem Verantwortlichen eine rechtmäßige Einwilligung geben kann, ohne je informiert worden zu sein, und entgegen seiner erklärten Aussage, gerade keine Einwilligung gegeben zu haben.
Leider zu spät habe ich bemerkt, dass nun auch das IDSG seine ersten öffentlichen Verhandlungen hatte – schon am 13. Januar wurden zwei Fälle verhandelt. In der hier am Montag besprochenen Dissertation zum kirchlichen Datenschutzrecht hatte Michaela Hermes noch die in der KDSGO fehlende Öffentlichkeit verteidigt: »Der grundsätzliche Ausschluss der mündlichen Verhandlung, wie er auch in kanonischen Prozessrecht üblich ist, das den Öffentlichkeitsgrundsatz nicht realisiert, steht der Gewähr eines effektiven Rechtsschutzes nach Art. 47 GRCh nicht entgegen. Denn der EuGH hat unter Hinweis auf seine Rechtsprechung zu Art. 6 EMRK festgestellt, dass es keine absolute Verpflichtung zur Durchführung einer öffentlichen Verhandlung gibt.« Schön, dass die Tendenz der Gerichte dahin zu gehen scheint, mündliche Verhandlungen grundsätzlich öffentlich zu machen. Dann braucht man sich gar keine komplizierte Rechtfertigung zurechtlegen.
Weiterhin intransparent sind die für Datenschutz zuständigen Verwaltungsgerichte der EKD, die seit 2018 gar keine Entscheidungen veröffentlicht haben. Anfragen an die Pressestelle (die trotz der Unabhängigkeit der Kirchengerichte als Kontaktadresse für Presseanfragen angegeben wird), ob und wie viele Fälle mit DSG-EKD-Bezug entschieden wurden, wurden seit Oktober 2020 (!) nur mit Vertröstungen beantwortet. Erst in diesem Monat habe ich einen direkten Kontakt für Presseanfragen bei den Kirchengerichten bekommen. Dort gab es wenigstens prompt eine Eingangsbestätigung.