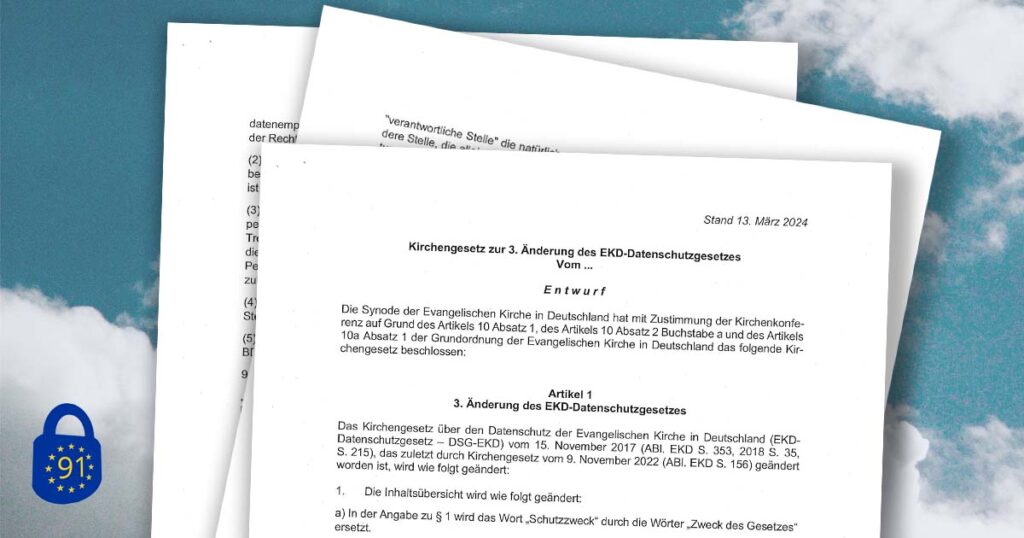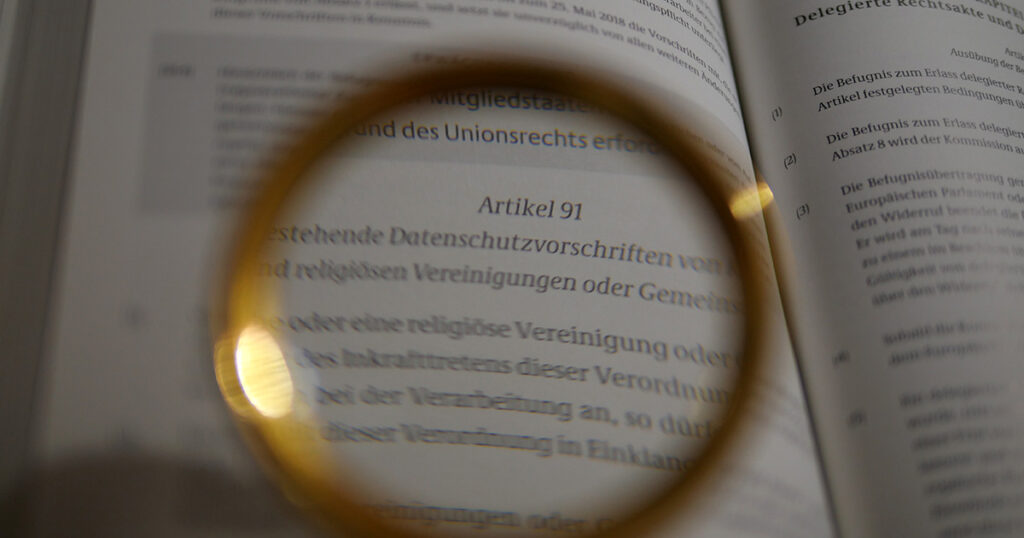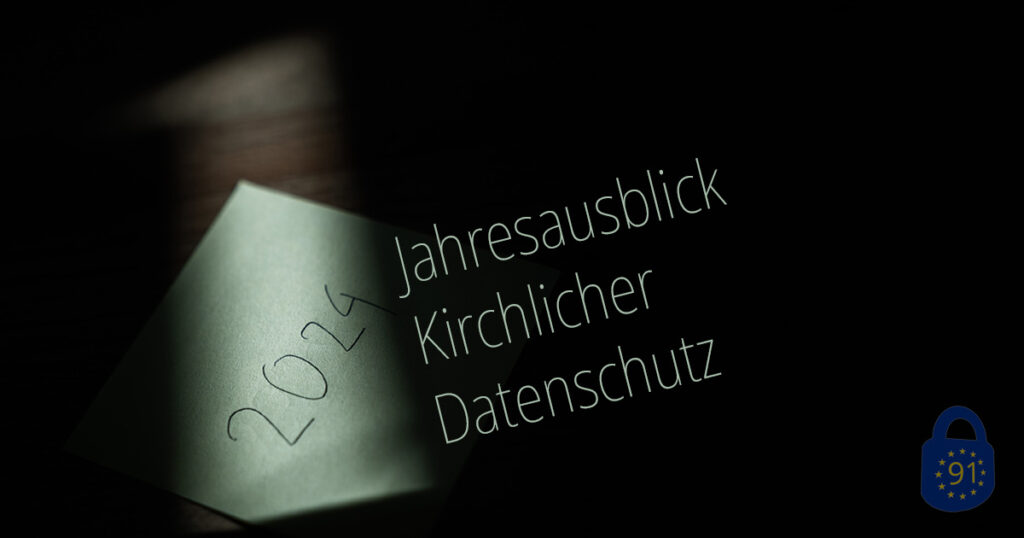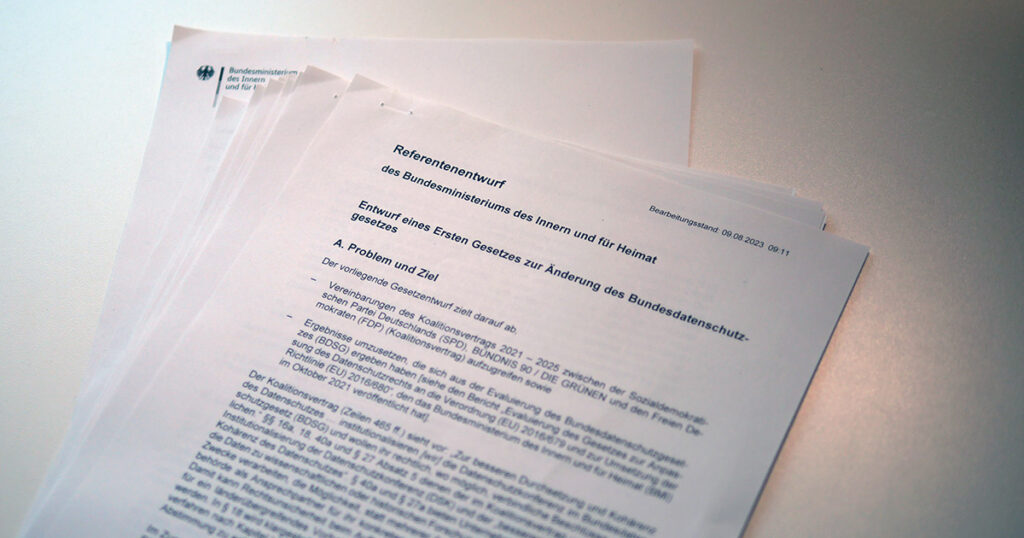Zwei der drei Ansprechpersonen für sexuellen Missbrauch im Bistum Augsburg sind unter Protest zurückgetreten. Die beiden werfen der Bistumsleitung unter anderem mangelnde Aufarbeitungs- und Dialogbereitschaft vor. Ein konkreter Vorwurf betrifft den Datenschutz von Personalakten und die fehlende Möglichkeit der Akteneinsicht für die Ansprechpersonen.

Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen erläutern Angelika Hauser und Rupert Membarth ihre Kritik, das Bistum Augsburg reagierte mit einer Stellungnahme. Damit lässt sich immerhin die datenschutzrechtliche Seite beurteilen.
Weiterlesen