Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
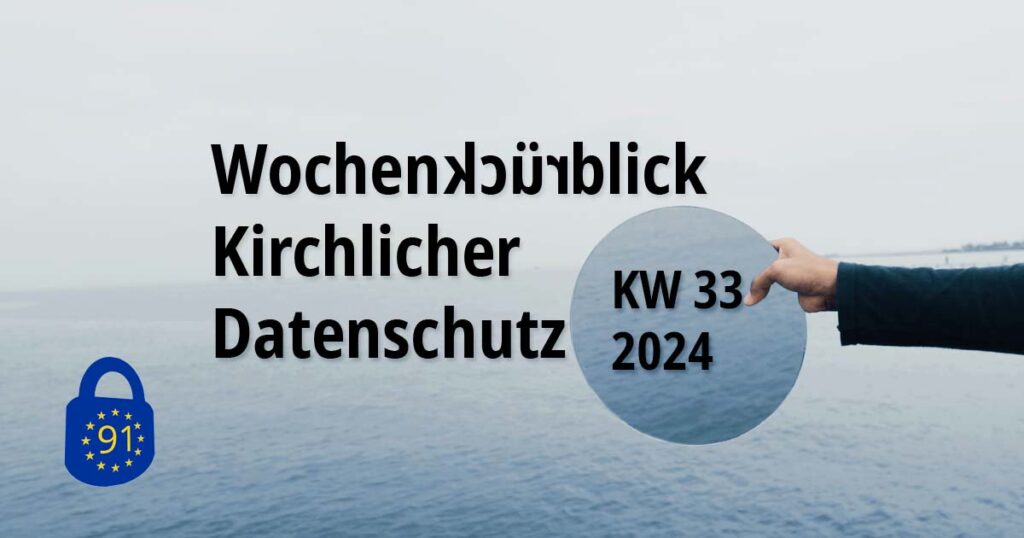

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
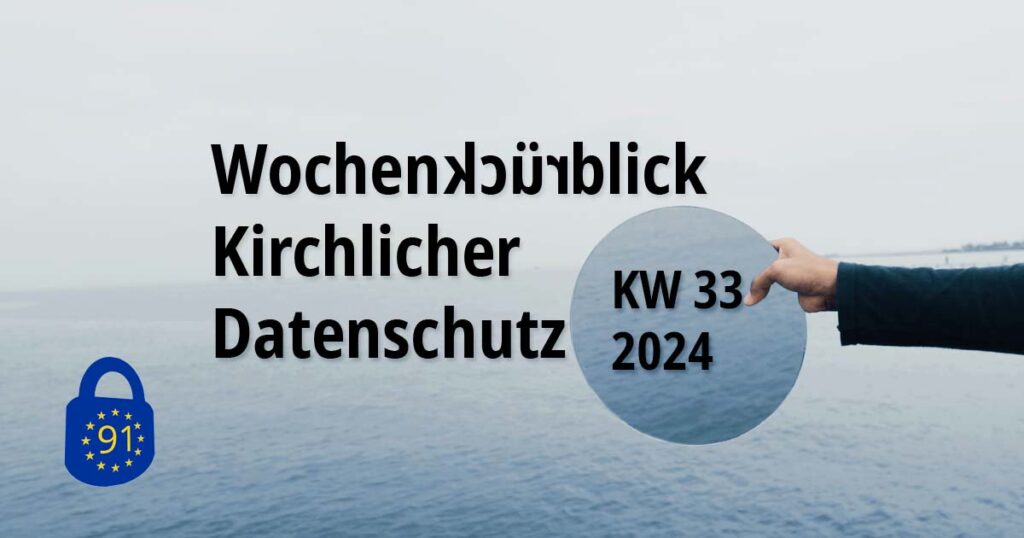
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
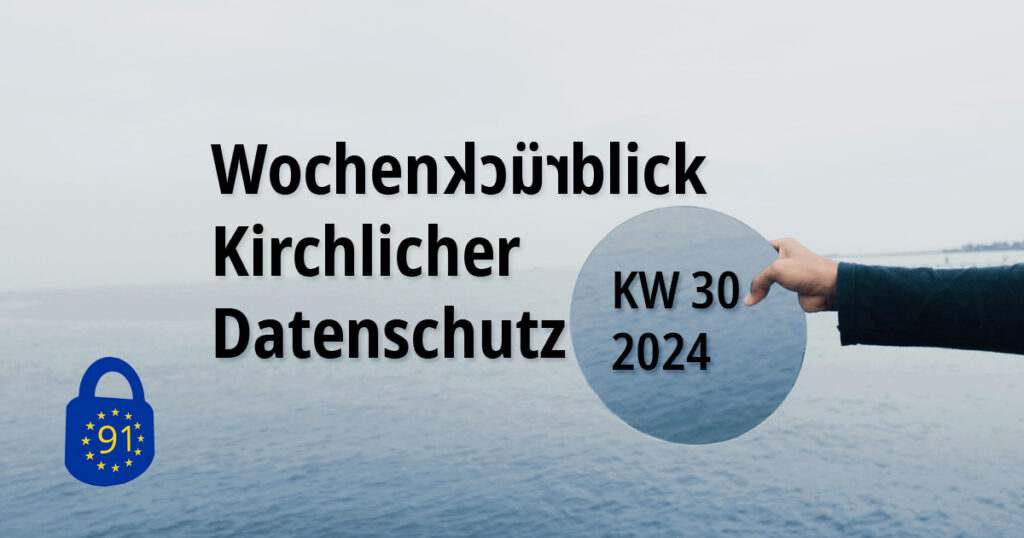
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
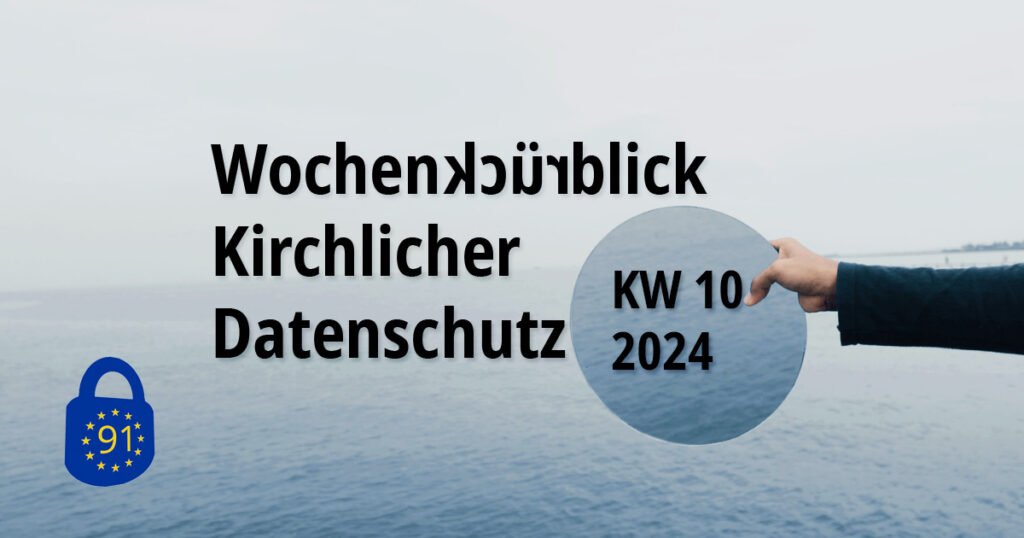
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
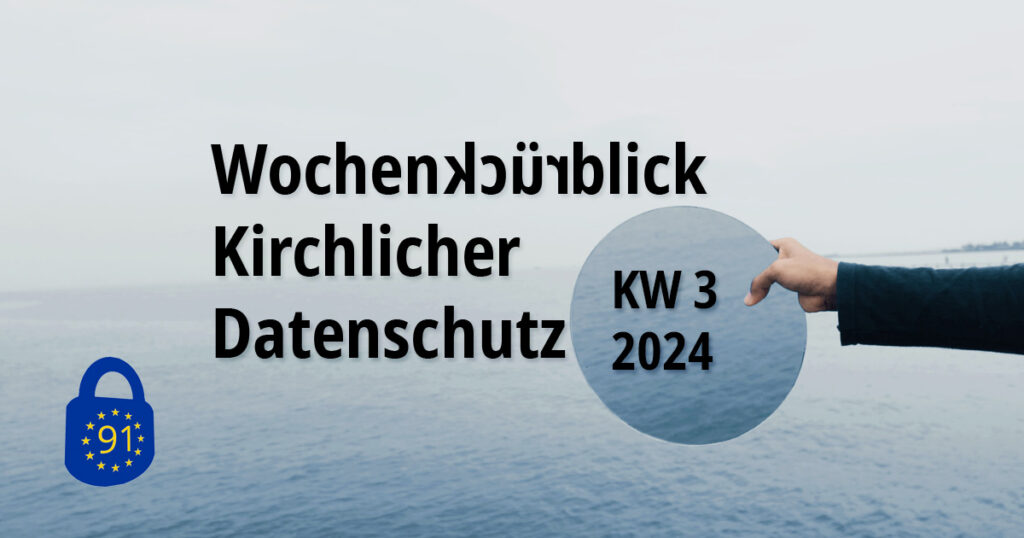
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
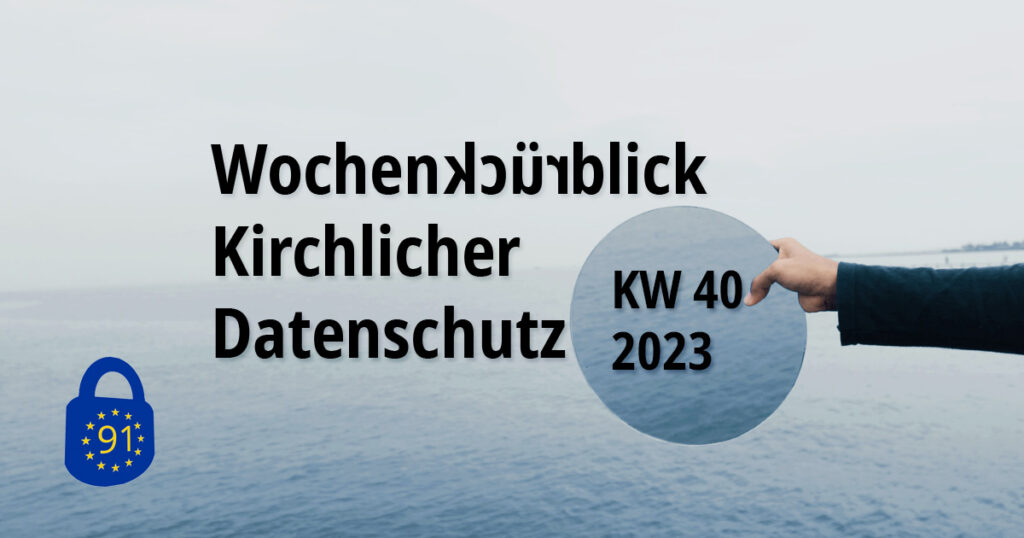
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
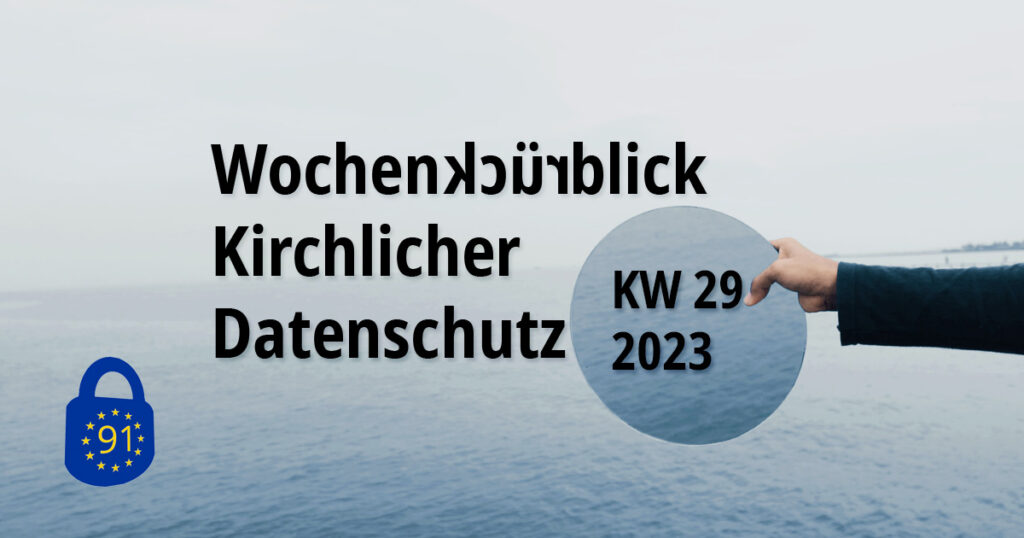
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Zumindest selektiv funktioniert das Löschkonzept im Erzbistum Köln: Die Liste mit Missbrauchstätern, die sich Kardinal Rainer Maria Woelki 2015 vorlegen ließ und von der er heute nicht mehr weiß, ob einer der prominentesten Priester seiner Erzdiözese (oder sonst jemand) darauf stand, wurde nach Kenntnisnahme geschreddert. Datenschutzgründe, sagte das Erzbistum gegenüber der KNA. Auch wenn dieser Vorgang etwa von der Maria-2.0-Sprecherin Maria Mesrian auf Facebook als vorgeschoben betrachtet und als »Gipfel der Niedertracht« bezeichnet wird: Bei all den Ungereimtheiten könnte das Schreddern gemäß § 6 Abs. 1 der damals geltenden Ausfbest DS IT, der die datenschutzgerechte Vernichtung von EDV-Ausdrucken und Datenmaterial regelt, sogar legal und angezeigt gewesen sein. (Ergänzung: Falls man nicht annimmt, dass hier die Pflicht bestanden hätte, das dem zuständigen kirchlichen Archiv gemäß § 6 KAO anzubieten, wie Thomas Schüller anmerkt.) Mit dem Schönheitsfehler, dass punktgenau diese Liste vernichtet wurde, während andere für das Gercke-Missbrauchsgutachten zur Verfügung standen.
In der aktuellen Folge von Margot Käßmanns Podcast »Was mich bewegt« geht es um die »Last der Öffentlichkeit« und den Wert der Privatsphäre. Die ehemalige Hannoveraner Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende berichtet darin über ihr Verhältnis dazu, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein – und was das für die Familie bedeutet. Und den Hund der Familie. Das Gespräch lohnt sich anzuhören: Persönliche Erfahrungen und Eindrücke werden mit sozialethischen Reflexionen verbunden.
Die Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach hat ein von Lars Schäfers verfasstes Arbeitspapier veröffentlicht: »Die katholische Soziallehre vor den Herausforderungen der Digitalität als sozialer Frage« fasst den bisherigen Stand der Entwicklung kompakt zusammen. Ähnlich wie ich selbst vor einigen Jahren bei y-nachten kommt auch Schäfers mit Blick auf die lehramtliche Sozialverkündigung zum Schluss, dass da (auch heute noch) nicht viel ist, und dass eine Digitalenzyklika wesentliche Impulse geben könnte. Auch wenn das wenige, was es an päpstlicher Sozialverkündigung zum Digitalen gibt, dann doch eher zu pessimistisch ist.
In eigener Sache: Am 21. September um 18 Uhr leite ich bei der Stiftung Datenschutz ein Webinar zu Besonderheiten im Bereich des kirchlichen Engagements – die Teilnahme ist kostenlos.
Nach Juli Zeh im letzten Jahr greift der Diözesandatenschutzbeauftragte für die Ostbistümer und den Militärbischof Matthias Ullrich in die Glückskeks-Kiste: »Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung« stellt er seinem Tätigkeitsbericht für 2021 voran und setzt damit einen etwas optimistischeren Akzent als im vergangenen Jahr – verbunden mit dem Appell, mit den eigenen Daten und denen anderer gut umzugehen.

Noch einmal ist Bericht über ein Corona-Jahr zu erstatten, das schlägt sich natürlich auch in besonderen Problemkreisen wie Impfstatusabfrage im Beschäftigungsverhältnis nieder. Dazu kommen wie jedes Jahr im Osten klare politische Ansagen zu staatlicher Überwachung und praxisnahe Tipps. Was leider auch hier wieder fehlt: Klare Zahlen zur Aufsichtstätigkeit.
WeiterlesenIn vielen kleinen Vereinen gilt Datenschutz vor allem als eins: lästig. Anders in der Katholischen jungen Gemeinde Rheinbach – den Leiter*innen des Jugendverbandes ist es wichtig, für Kinder und Jugendliche einen sicheren Ort zu schaffen. Dazu gehört auch, die Privatsphäre zu achten und informationelle Selbstbestimmung zu wahren. Datenschutz wird dort deshalb nicht nur als Pflichtaufgabe angesehen, sondern aktiv gestaltet. Im Interview erzählt Berni Escamilla, Mitglied der Pfarrleitung und des Datenschutz-Komitees, wie es dazu kam und was andere Vereine von der KjG Rheinbach lernen können.

Frage: Ihr beschäftigt euch seit einigen Jahren sehr viel damit, wie ihr eure Jugendarbeit datenschutzkonform gestalten könnt. Warum hat das für euch einen so großen Stellenwert?
Bernardo Escamilla: Zum einen, weil wir einfach auf der richtigen Seite des Gesetzes stehen wollen, aber auch, weil wir umfassend auf unsere Mitglieder und besonders die Kinder achtgeben wollen. Wir sehen unseren Auftrag nicht nur darin, den Kindern einen Freiraum zu geben, in dem sie sich entfalten und entwickeln können, wir wollen diesen Freiraum auch so gestalten, dass er so gut es geht ein sicherer Raum für Kinder ist. Alle unsere Leiter nehmen an den Schulungen des BDKJ zur Prävention sexualisierter Gewalt teil, und genauso halten wir es für sinnvoll, beim Datenschutz auf diese Aspekte zu achten.
WeiterlesenAbonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Der Datenschutzbeauftragte für Kirche und Diakonie hat eine 12-Punkte-Liste für die Überprüfung oder Planung des datenschutzkonformen Einsatzes eines Videokonferenzsystems veröffentlicht – sicherlich eine nützliche Grundlage für die Einführung, wenn auch zur vierten Welle doch etwas spät: Wer hat jetzt noch kein Videokonferenzsystem? Rechtlich ist an der Handreichung nichts zu beanstanden und für Menschen, die mit Datenschutz vertraut sind, auch ohne Überraschungen. Für alle anderen muss sie aber befremdlich wirken. Sicher hat eine Videokonferenz eine höhere Eingriffsintensität als andere Kommunikationsmittel. Aber gibt es auch nur vergleichbare Checklisten für Telefon, E-Mail und Fax? Muss man sich wirklich noch die Frage stellen, ob eine Videokonferenz im Vergleich zu Telefonkonferenzen »erforderlich« ist? Stellt sich jemand die Frage, ob ein Telefonat im Vergleich zu einer E-Mail im Vergleich zu einem Brief im Vergleich zu einem persönlichen Besuch »erforderlich« ist? Besser wird das wohl erst, wenn Videokonferenzen für alle so unauffällig wie Telefone sind.
Im aktuellen Tätigkeitsbericht des KDSZ Frankfurt ist die Rede von einem Versuch, ein staatliches Verwaltungsgericht für eine Klage gegen eine Entscheidung der kirchlichen Aufsicht zu bemühen, leider ohne Aktenzeichen und Gericht zu nennen. Daher habe ich weiter recherchiert: Auf Nachfrage teilte mir das Verwaltungsgericht Frankfurt mit, dass das Klageverfahren (Az. 5 K 1077/20.F) ohne eine sachliche Entscheidung nach Klagerücknahme beendet und durch Beschluss vom 6. August 2020 eingestellt wurde. »Darauf, dass die Klage auf dem Verwaltungsrechtsweg nicht zulässig, eine Verweisung an das Interdiözes Datenschutzgericht aber auch nicht möglich ist, ist bereits in der Eingangsverfügung hingewiesen worden«, so der Vorsitzende der fürs Datenschutzrecht zuständigen 5. Kammer. Die Zitate aus dem Tätigkeitsbericht stammen daher nicht aus einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache, sondern, so das Gericht, wohl lediglich aus einer Ablehnung einer Bewilligung von Prozesskostenhilfe.
Das in der vergangenen Woche schon erwähnte Urteil des OLG Düsseldorf hat die KDSA Ost zum Anlass genommen, noch einmal einzuschärfen, wie problematisch von ihr Kinderfotos im Netz bewertet werden, inklusive dem Drohen mit Pädophilen, die Kinderfotos abgreifen und einem locker sitzenden Bußgeldfinger. Wieder kommt die Mahnung ohne jegliche Differenzierung, um was für Bilder es sich handelt – und (ich wiederhole mich) ohne zu bedenken, dass Kinder und Jugendliche nicht nur Sicherheitsinteressen, sondern auch Teilhabe- und Repräsentanzinteressen haben. Ein besserer Ansatz wäre, sowohl objektiv untragbare Darstellungen (Nacktheit, entwürdigende Situationen) zu benennen wie medienpädagogische Methoden zu zeigen, um mit den Betroffenen selbst ins Gespräch kommen, welche Darstellungen sie selbst in der Öffentlichkeit haben wollen und welche Möglichkeiten bestehen, informationelle Selbstbestimmung auszuüben.