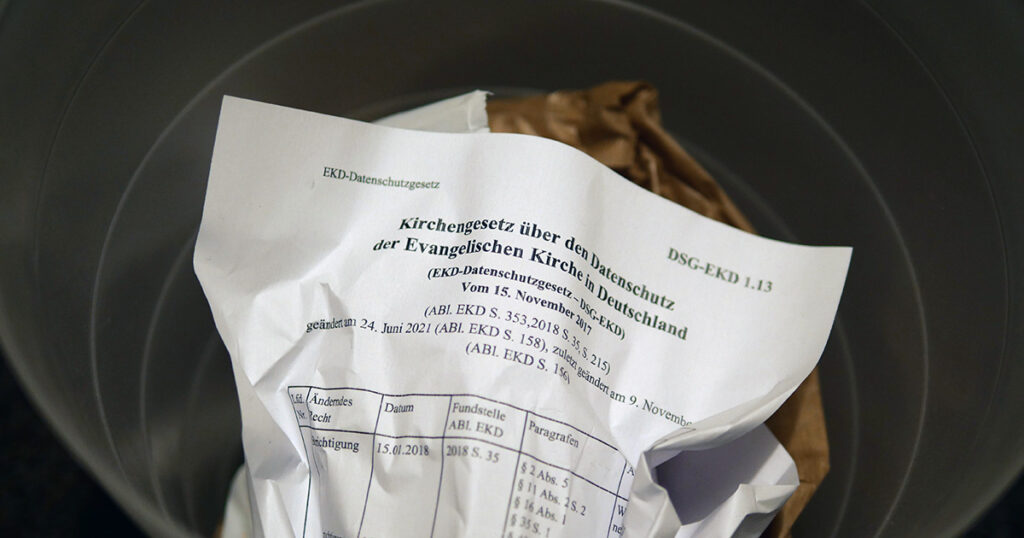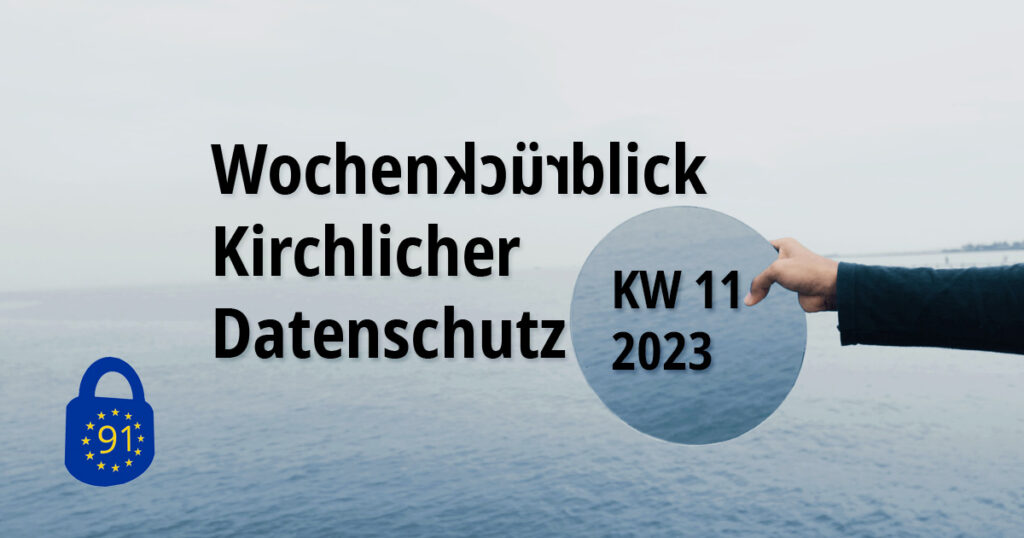Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
Nach dem forschen Vorstoß aus Bayern mit einem »Facebook-Verbot« hat sich die zweite katholische Aufsicht geäußert. Die KDSA Ost erläutert, dass der Bescheid des BfDI gegen das Bundespresseamt keine neue Rechtslage erzeugt, sondern nur die Konsequenz aus der bisherigen Bewertung der DSK ist. Die bayerische Entscheidung kommentiert er wohlwollend, aber sichtlich bemüht, die irreführende und rechtlich nicht gedeckte Rede vom »Facebook-Verbot« nicht aufzugreifen: »Auch die Datenschutzkonferenz der katholischen Datenschutzaufsichten hat wiederholt auf diese Rechtslage hingewiesen. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Diözesandatenschutzbeauftragte für die bayrischen Bistümer ankündigt, nach einer von ihm gewährten Frist, gegen Verantwortliche vorzugehen, die weiterhin eine Facebook-Fanpage betreiben.« Für den Bereich seiner Aufsicht rät der Ost-DDSB dazu, datenschutzkonforme Alternativen zu suchen, ohne eine konkrete Offensive anzukündigen. Auch das KDSZ Dortmund hält an seiner Einschätzung fest. Beratungen und Auskünfte zum Betrieb von Facebook-Fanseiten durch die Aufsicht hätten trotz der ablehnenden Haltung in den meisten Fällen nicht dazu geführt, »dass die kirchlichen Stellen einen aus Sicht der Datenschutzaufsichten datenschutzkonformen Betrieb der Facebook-Fanpages erreicht haben bzw. die Fanpages aus diesem Grund (nicht mehr) unterhalten haben«. Die NRW-Aufsicht kündigte an, in den nächsten Monaten bei Prüfungen und Beschwerden verstärkt auf dieses Thema zu achten und gegebenenfalls zu handeln. Der BfD EKD erinnert wie zuvor schon der DSBKD an die Entschließung der evangelischen Datenschutzkonferenz. »Kirchliche und diakonische Stellen müssen demnach den datenschutzkonformen Einsatz von Facebook Fanpages nachweisen können«, heißt es ohne die Ankündigung weiterer Eskalation seitens der Behörde.
Im Publik-Forum fordert der Sprecher des Betroffenenbeirats bei der Deutschen Bischofskonferenz, Johannes Norpoth, ein Recht auf Akteneinsicht und auf individuelle Aufarbeitung für Betroffene von Missbrauch: »Um endlich für Waffengleichheit zu sorgen, müssen Betroffene und Opfer in alle Akten und Dokumente Einsicht nehmen können, die in Zusammenhang mit der Straftat und deren anschließender Vertuschung stehen – unabhängig vom Fund- und Archivort.« Das gelte besonders für die kirchlichen Archive, die sich dem staatlichen Zugriff bisher entzögen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Bistümer ihren eigenen Aufarbeitungskommissionen und Studieninstituten die Einsichtnahme verwehren oder massiv erschweren, selbst wenn es um anonymisierte Daten gehe. »Das Vorenthalten von Informationen, die eine lückenlose und vollständige Aufklärung von Missbrauchstaten im Raum der Kirche ermöglichen, ist quasi das i-Tüpfelchen auf der moralischen Bankrotterklärung klerikaler Bewahrer«, betont Norpoth. Der Staat müsse alle Mittel ausschöpfen trotz hoher rechtlicher Hürden: »Das umfassende Akteneinsichtsrecht muss für alle Archivstrukturen der betroffenen Organisation gelten«, fordert Norpoth.
Bislang hat sich von Seiten von Religionsgemeinschaften nur die katholische Kirche im Gesetzgebungsprozess zur geplanten EU-Verordnung zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingebracht, hat eine Informationsfreiheitsanfrage bei der Europäischen Kommission ergeben. Der Verordnungsentwurf ist aufgrund der geplanten massiven Eingriffe in die Kommunikationsfreiheit (»Chatkontrolle«) hoch umstritten. Aus einer Mitschrift der Kommission aus der COMECE-Rechtskommission geht auch eine Datenschutzfrage im Kontext von Missbrauchsprävention hervor: Eine Person berichtete (wahrscheinlich aus Irland, das Treffen fand unter Chatham House Rules statt, also ohne Identifikation der Sprechenden) von den Schwierigkeiten der nationalen kirchlichen Stelle für Kinderschutz, Daten zu verdächtigen Priestern weiterzugeben: »Reference to a GDPR issue that prevents non-statutory bodies on sharing information on at-risk priests moving from parish to parish, and where the National Board set up as a central body to coordinate such information sharing is without a legal basis to access case files.«
Weiterlesen →