Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
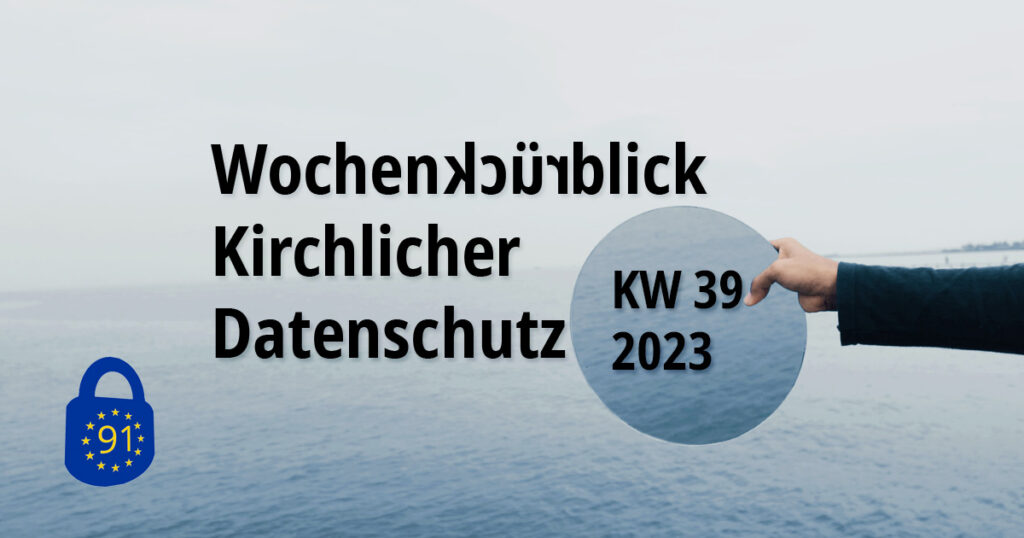

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
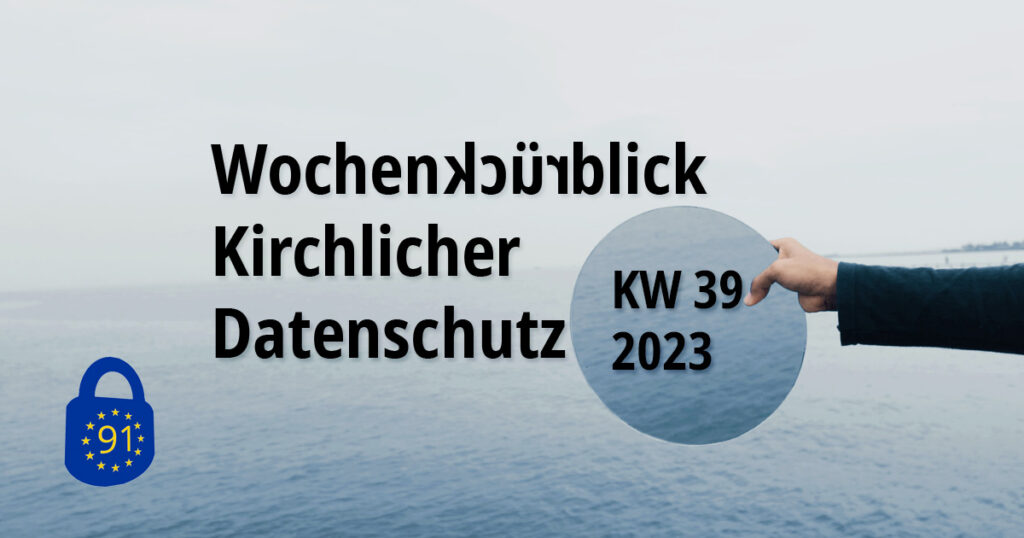
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
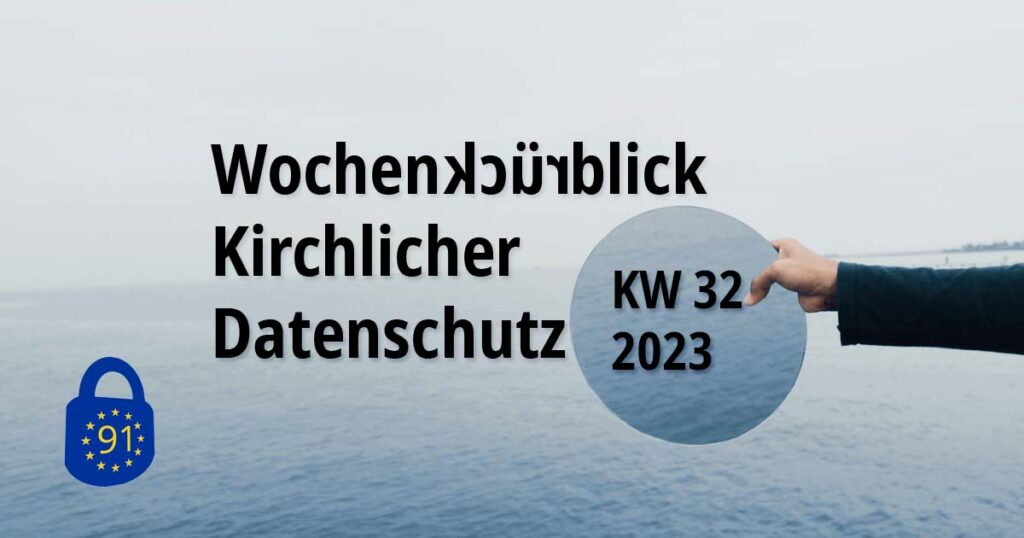
Das erste Bistum hat seine Regelungen zur Verwendung von Akten zur Missbrauchsaufarbeitung mit Blick auf den Datenschutz überarbeitet. Im aktuellen Amtsblatt des Bistums Fulda wird das im Februar 2022 erstmals promulgierte »Gesetz zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten der Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener« zum zweiten Mal geändert.

Das Gesetz aus Fulda war von Anfang an eigenständig und orientierte sich nicht an der DBK-Musterordnung, die seit einigen Wochen in der Kritik steht. Außer Fulda hat nur noch Speyer den Weg einer eigenständigen Regelung eingeschlagen. Nach der Novelle sind in Fulda die Rechte von Missbrauchsbetroffenen gestärkt, die von Beschuldigten geschwächt.
WeiterlesenDer Arbeitskreis der Betroffenenbeiräte und -vertretungen bei den deutschen Diözesen hat (über die Betroffeneninitiative Ost) eine ausführliche Stellungnahme zur Musterordnung zur Akteneinsicht und -auskunft veröffentlicht. Die Stellungnahme reagiert auf eine darin erwähnte Position der KDSA Ost, die anscheinend ein überwiegendes erhebliches kirchliches Interesse an der Verwendung aller Betroffenendaten für die Aufarbeitung von Missbrauch bejaht. Dagegen wenden sich die Betroffenenbeiräte – erneut – deutlich. Angeführt werden sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden: Der vorhandene Datenbestand zu Missbrauch sei schon hinreichend groß, um nicht jeden bekannten Fall in Analysen einzubeziehen.

Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
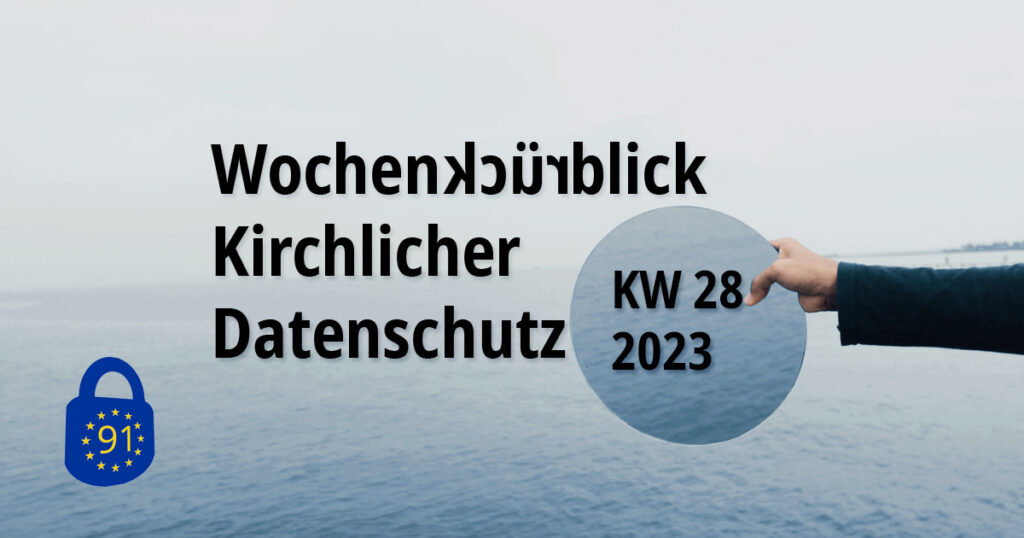
Nach dem Betroffenenbeirat Ost äußert auch der Arbeitskreis der Betroffenenbeiräte und -vertretungen massive Kritik an der »Musterordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten« zur Missbrauchsaufarbeitung. In einer Stellungnahme vom Samstag widerspricht der Arbeitskreis der Umsetzung: »Der Arbeitskreis bestreitet, dass das öffentliche Interesse an Aufarbeitung das berechtigte Interesse von Missbrauch betroffener Personen am Schutz ihrer sensiblen personenbezogenen Daten überwiegt.«
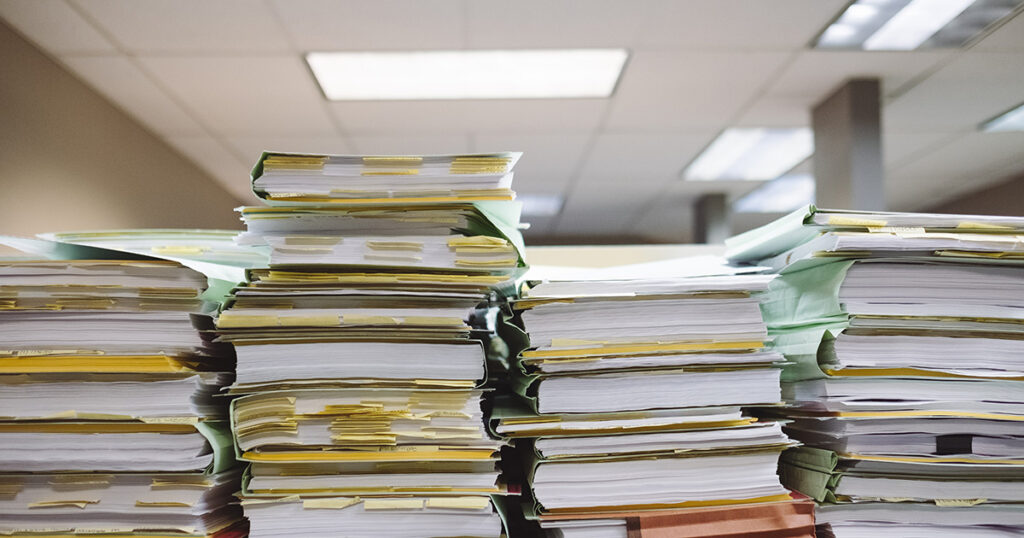
In seiner Stellungnahme zitiert der Arbeitskreis auch eine bisher nicht bekannte Erläuterung des Berliner Erzbischofs Heiner Koch vom 6. Juli, die er dem Betroffenenbeirat Ost mitgeteilt hatte. Aus der Ausschnitt geht hervor, dass es bei der Ausarbeitung der Musterordnung zwar eine umfangreiche Beteiligungsphase gab, bei der unter anderem Aufarbeitungskommissionen beteiligt, aber ausgerechnet die Betroffenenbeiräte der Diözesen und bei der Deutschen Bischofskonferenz ausgelassen wurden.
WeiterlesenAbonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
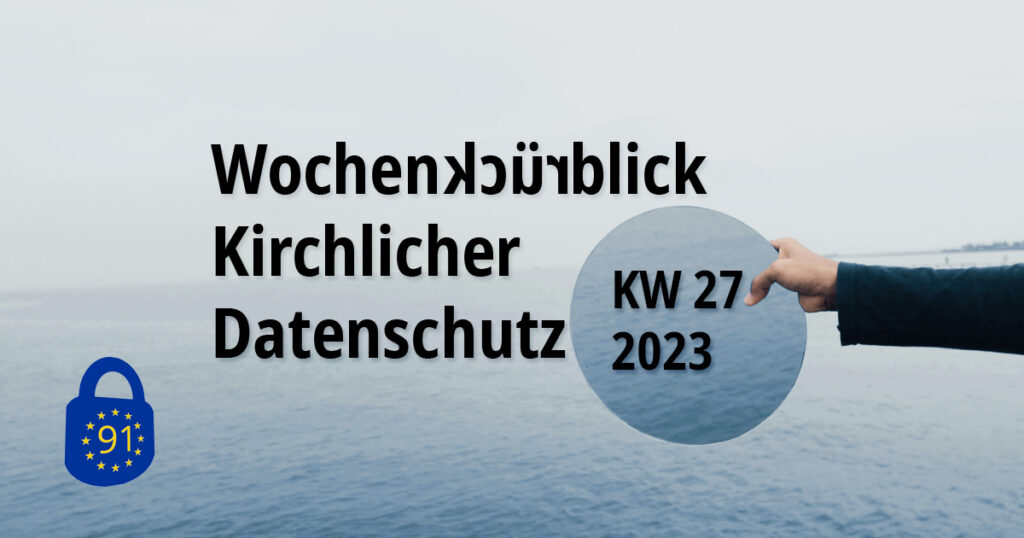
Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.

Akten sind zentral für die Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche: Personalakten, Sachakten, historische Bestände und aktuelle Unterlagen aus dem Verfahren zur Anerkennung des Leids, mit dem in der katholischen Kirche Zahlungen von Betroffenen organisiert sind. Diese Akten enthalten notwendig besonders sensible Daten, auch dann, wenn einzelne Bestände nicht unter die besonderen Kategorien personenbezogener Daten fallen.

Datenschutzrechtlich ist daher eigentlich klar: Es braucht eine Rechtsgrundlage. Das Bistum Münster wurde nun auf eine Beschwerde einer betroffenen Person hin vom zuständigen KDSZ Dortmund gerügt – für die Weitergabe von (nicht genug) anonymisierten Akten an die unabhängige Forschergruppe, die die Missbrauchsstudie für das Bistum angefertigt hat, fehlte es an einer Rechtsgrundlage.
Weiterlesen