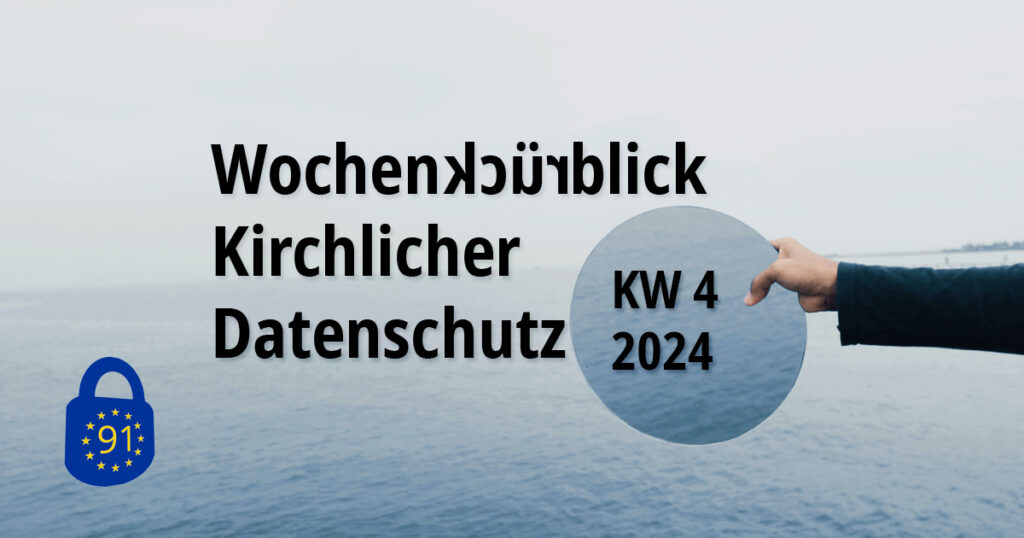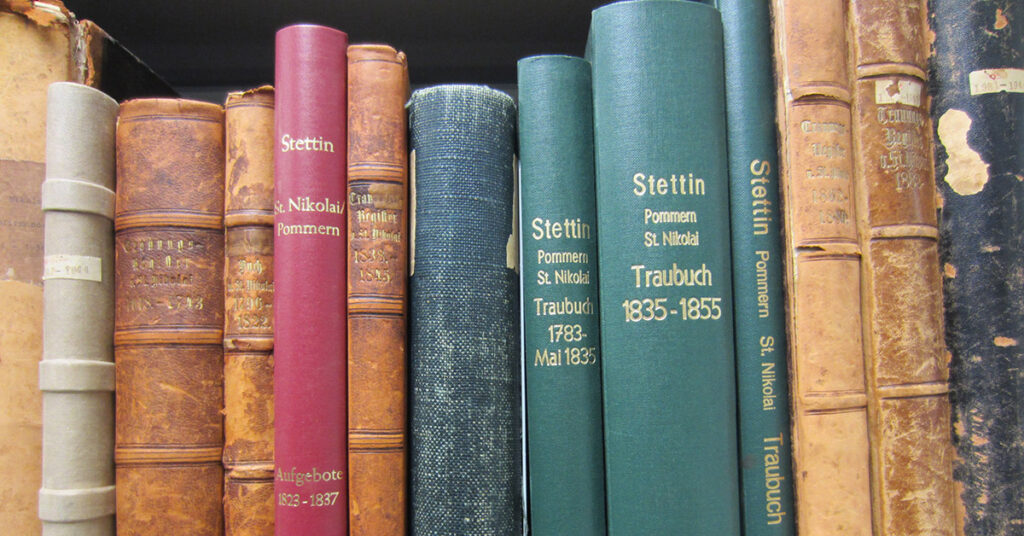Auch in Frankreich müssen Kirchen Einträge aus Taufbüchern nicht löschen. Der französische Conseil d’État hat in seiner Funktion als oberstes Verwaltungsgericht am Freitag einen Einspruch gegen eine Entscheidung der Datenschutzaufsicht CNIL zurückgewiesen. Schon die Aufsicht hatte die Beschwerde eines ehemaligen Katholiken abgelehnt, seinen Taufeintrag zu löschen.

Der Staatsrat folgt mit Entscheidung dem europäischen Trend, dass das Interesse der Kirche das Interesse von Betroffenen bei der Führung von Taufbüchern überwiegt. In den vergangenen Jahren hatten europaweit Aufsichten und Gerichte diese Rechtsauffassung vertreten, zuletzt die irische Aufsicht. Die jüngst veröffentlichte gegenteilige Auffassung der belgischen Aufsicht ist weiterhin deutlich in der Minderheit. Die sehr kurz gefasste französische Entscheidung zeigt auf kleinem Raum die Argumentation für eine Ablehnung von Löschrechten im Taufbuch.
Die Entscheidung im Volltext: Conseil d’État, Beschluss vom 4. Februar 2024, Az. 461093 (ECLI:FR:CECHR:2024:461093.20240202).
Weiterlesen