Abonnent*innen des Artikel-91-Newsletters haben den Wochenrückblick und exklusive Newsletter-Inhalte schon vor Veröffentlichung im Blog erhalten – hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung.
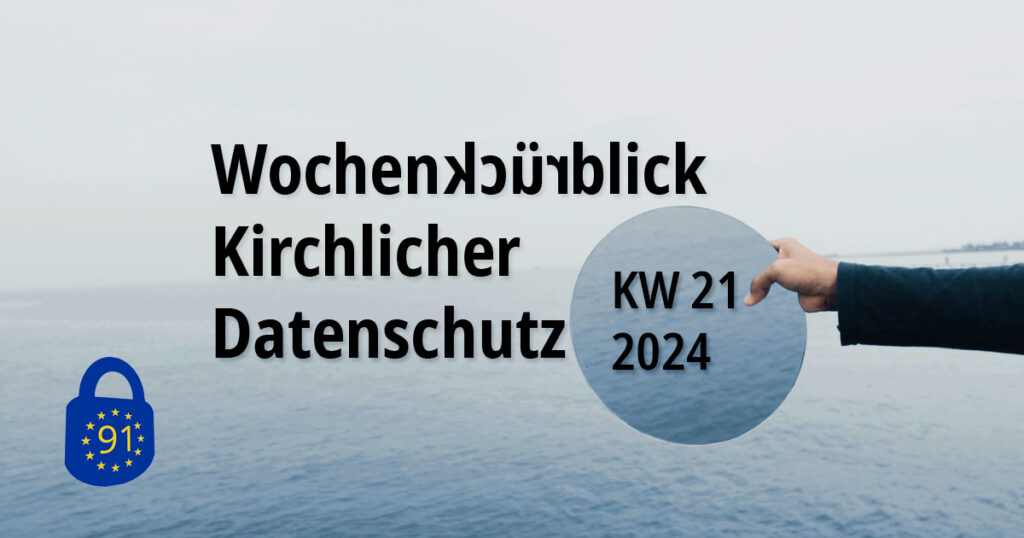
Die Woche im kirchlichen Datenschutz
Razzia im Pfarrhaus – ohne Respekt für Seelsorgedaten
Im neuen sehr hörenswerten Podcast »Systemeinstellungen« von netzpolitik.org befasst sich die zweite Folge mit Kirchenasyl. Ingo Dachwitz recherchiert, wie immer härter gegen Gemeinden und Pfarrer*innen durchgegriffen wird, die Kirchenasyl gewähren. Dabei scheint es seitens der Behörden keinerlei Sensibilität für den geschützten Raum der Seelsorge zu geben: »Bei den Pastor:innen kam es zu Hausdurchsuchungen. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Daten von dienstlichen und privaten Computern und Smartphones – trotz Warnungen, dass darauf auch seelsorgerisch sensible Daten von Gemeindemitgliedern sein könnten. Ein Gericht erklärte die Hausdurchsuchungen später für rechtswidrig«, schreibt Dachwitz. Die Podcast-Folge war für das Eule-Magazin der Anlass, einen Schwerpunkt auf das Thema Kirchenasyl zu legen. Einen Überblick gab es in den Links am Tag des Herrn am vergangenen Sonntag. Die Erkenntnisse über den mangelhaften Respekt vor sensiblen Daten in Pfarrhäusern sollte ein Anlass sein, noch einmal genau über die eigene Verarbeitung von Seelsorgedaten nachzudenken.
Elternrechte in praktischer Konkordanz
Der IDSG hat eine weitere Entscheidung im Zusammenhang mit einer konflikthaften Sorgerechtssituation veröffentlicht (IDSG 11/2023 vom 5. April 2024). Wieder geht es um das Auskunftsrecht eines Vaters. Anders als bei einer anderen hier besprochenen Entscheidung ist das Kind zu jung, um selbst beteiligt zu werden. Der Streit dreht sich unter anderem darum, wie stark die Kopien, die Daten zum Vater, zur Mutter und zur Tochter enthalten, geschwärzt werden müssen bei der Auskunftserteilung an den Vater. Das Gericht will eine praktische Konkordanz zwischen »der Rechtsposition des Betroffenen, der die Auskunft verlangt, und den Grundrechten der anderen Betroffenen« herstellen: »Dies führt in der Regel dazu, dass einerseits nicht jegliche Auskunft versagt werden darf und dass andererseits eine umfassende Auskunft – insbesondere ohne Vornahme von Schwärzungen und von anderen entsprechenden Beschränkungen – nicht erteilt werden darf« (Rn 47). Im vorliegenden Fall, in dem die Eltern gemeinsam sorgeberechtig sind, heißt das, dass die Mutter »bestimmte Einschränkungen ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung hinnehmen« muss. Beide Eltern müssen »Zugang zu den Informationen betreffend das Kind erhalten[…], die zur verantwortlichen Wahrnehmung der elterlichen Sorge erforderlich sind«.
Messenger-Kommunikation in der Pfarrgemeinde
Am Pfingstsonntag kündigte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende meiner Pfarrei in den Vermeldungen nach der Messe an, dass die Gemeinde jetzt auch Informationen über Messenger teilt, und ich dachte schon »schön, aber gleich sagt er ›WhatsApp‹«. Aber dann hieß es: Signal-Gruppe. Geht doch – auch an der Basis und weitgehend ehrenamtlich wird zumindest versucht, datensparsame Dienste einzusetzen.
Noch ein Nutzen: Wenn Leute durch die Pfarrei-Gruppe auf Signal gezogen werden, wird es künftig einfacher, sich in der Pfarrei über Signal zu organisieren. Über einen exklusiven Dienst (über keinen anderen Messenger gibt es die Pfarrei-Gruppe) werden Gemeindemitglieder animiert, einen sicheren Messenger zu installieren, obwohl sie mit größter Wahrscheinlichkeit schon WhatsApp haben.
Kein Recht auf Taufbuch-Änderung für Transpersonen in Mexiko
Die mexikanische Diözese Querétaro muss den Eintrag einer Transfrau im Taufregister nicht ändern. Die Frau hatte verlangt, den dort eingetragenen männlichen Namen und Geschlechtseintrag zu korrigieren. Das zuständige Berufungsgericht folgte der Entscheidung der Datenschutzaufsicht INAI nicht, die eine Korrektur noch für erforderlich gehalten hatte. Die im Boletín Jurídico del Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y El Caribe veröffentlichte Entscheidung hebt auf den Unterschied zwischen staatlichen und kirchlichen Registern ab. Während in staatlichen Registern ein Recht auf den korrekten weiblichen Eintrag besteht, ist für kirchliche Register das Selbstverwaltungsrecht der Religionsgemeinschaft ausschlaggebend. Die Funktion des Taufregisters sei, »die Spendung des Sakraments der Taufe an eine Person und damit ihre Eingliederung in die Kirche sowie die Befreiung von ihren Sünden, ihre Wiedergeburt als Kind Gottes und ihre Hinführung zum Heil festzuhalten«. Die Weigerung, den Geschlechtseintrag zu ändern, hindere sie »in keiner Weise an der vollständigen Anerkennung der sexuellen und geschlechtlichen Identität, die sie für sich selbst definiert hat«.
Für derartige Fälle gibt es bereits seit 2002 universalkirchenrechtliche Vorgaben. Die Änderung des Personenstands ist in der Spalte »Bemerkungen« im Taufbuch einzutragen. In den letzten Jahren haben einige deutsche Diözesen ihre Ausführungsbestimmungen für die Eintragung »in speziellen Fällen« ausführlich geregelt; Datenschutzrechte und das Offenbarungsverbot des Transsexuellengesetzes und des bald in Kraft tretenden Selbstbestimmungsgesetzes werden durch Sperrvermerke umgesetzt. Anlässlich der ersten derartigen Norm im Erzbistum Freiburg habe ich 2022 mit Offizial Thorsten Weil über die Hintergründe gesprochen.
In eigener Sache
- Bei den Praxistagen Datenschutz & Informationssicherheit von Althammer & Kill vom 4. bis 6. September bin ich wieder als Referent dabei, dieses Mal voraussichtlich zum neuen DSG-EKD. (Anmeldung bei Althammer & Kill, 850 Euro, Frühbucherrabatt bis 31. Mai.)
Auf Artikel 91
Aus der Welt
- Der EuGH hat eine Vorlagefrage der österreichischen Unabhängigen Anti-Doping-Schiedskommission abgewiesen: Die Kommission sei kein Gericht und daher nicht vorlageberechtigt (EuGH, Urteil vom 7. Mai 2024, C 115/22). Gescheitert ist die Vorlage aufgrund der vom EuGH festgestellten mangelnden Unabhängigkeit, die das Gericht an der Möglichkeit der Abberufung von Richter*innen »aus wichtigem Grund« festgemacht hat. Die Entscheidung dürfte auch für die Frage relevant sein, ob die kirchliche Datenschutzgerichtsbarkeiten vorlageberechtigt sind. Die KDSGO sieht eine Abberufung von Richter*innen unter anderem durch die »Feststellung eines schweren Dienstvergehen« durch ein Dekret des Vorsitzenden der DBK vor (§ 6 Abs. 3 lit. b) KDSGO), das KiGG.EKD bei gröblicher Pflichtverletzung und wenn das »Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufsgerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung des Amtes nicht mehr zulässt« (§ 14 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KiGG.EKD). Zuständig ist hier der Rat der EKD. Das KiGG.EKD sieht den Rechtsweg zum EKD-Verfassungsgerichtshof vor, die KDSGO kennt keinen Rechtsweg, es dürfte damit der allgemeine kanonische Verwaltungsgerichtsweg greifen, also ein hierarchischer Rekurs bei der zuständigen Vatikan-Behörde. Es gibt also Argumente dafür, dass die Kirchengerichte vorlageberechtigte Gerichte sind (wie auch Martini/Botta argumentieren; dort wurde die Unabhängigkeit knapp geprüft und bejaht) – sicher ist aber nicht, dass die mehr oder weniger definierten Rechtswege dem EuGH genügen würden. (Danke an den Datenzirkus für den Hinweis auf die Entscheidung!)
