Die kirchlichen Datenschutzgerichte sprechen wie die meisten Gerichte primär durch ihre Entscheidungen. Erfreulich viele davon sind veröffentlicht, obwohl die KDSGO das nicht ausdrücklich vorsieht, so dass hier auch immer wieder die Rechtsprechung diskutiert werden kann. Über die operative Arbeitsweise und das Selbstverständnis des Gerichts geben Entscheidungen nur wenig Auskunft. Umso wertvoller ist es, wenn sich doch einmal Richter*innen äußern.
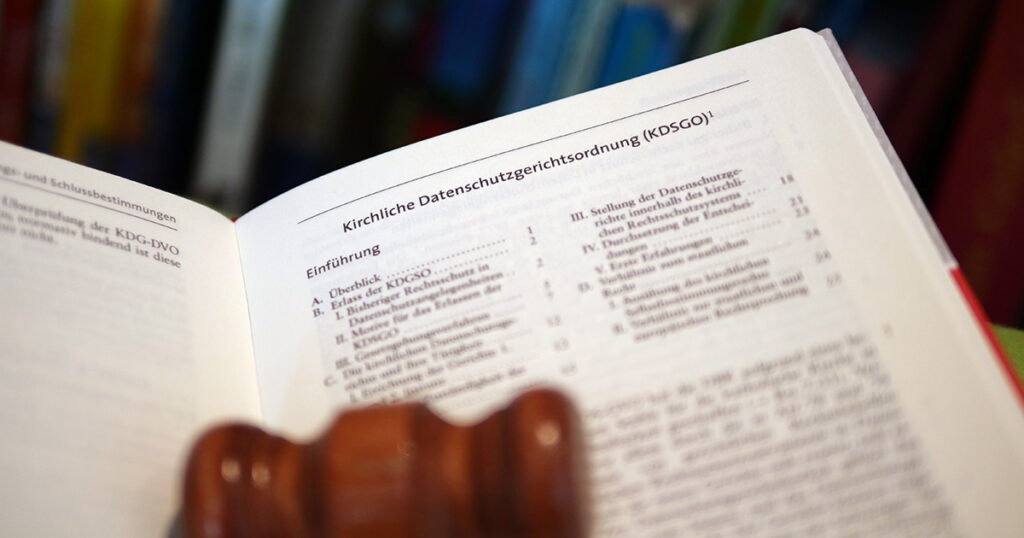
Nachdem bereits 2021 der Vorsitzende Richter des IDSG Bernhard Fessler in einem Vortrag einiges erzählte, gibt es nun auch vom Vorsitzenden Richter des DSG-DBK, also der zweiten Instanz, Einblicke. In der schon 2023 erschienenen Festschrift zum 80. Geburtstag des Münsteraner Kirchenrechtlers Klaus Lüdicke hat der Münsteraner Europarechtler Gernot Sydow (der auch Herausgeber des KDG-Kommentars ist) über die erste Amtsperiode des DSG-DBK geschrieben, die 2023 endete.
Fallstatistik der kirchlichen Datenschutzgerichte
Sydow nennt detailliert Zahlen zur Arbeit der Datenschutzgerichte. Insgesamt sind demnach bei beiden Instanzen zusammn in den fünf Jahren bis Frühjahr 2023 100 Verfahren eingegangen. Für die bis Ende 2022 entschiedenen Verfahren nennt Sydow die Erfolgsquoten.
| Ergebnis vor dem IDSG | Quote |
|---|---|
| (Teil-)Erfolg des Antrags | 21 % |
| Vergleich | 2 % |
| Rücknahme des Antrags | 29 % |
| Abweisung des Antrags | 48 % |
| Ergebnis vor dem DSG-DBK | Quote |
|---|---|
| Rücknahme des Antrags | 18 % |
| Vergleich | 9 % |
| (Teil-)Erfolg des Antrags | 73 % |
Bemerkenswert ist angesichts der genannten 100 Verfahren, von denen einige auch durch eine Rücknahme oder einen Vergleich nicht in einer Entscheidung mündeten, die Quote der veröffentlichten Entscheidungen. Mittlerweile sind um die 40 Entscheidungen der beiden Instanzen veröffentlicht – zuzuüglich der seit Redaktionsschluss von Sydows Statistik dazugekommen Fälle und abzüglich der Fälle ohne Entscheidung dürfte man auf eine Veröffentlichungsquote um die 50 Prozent kommen – im staatlichen Bereich sind es über alle Gerichte eher 1 Prozent der Entscheidungen, die veröffentlicht werden.
Jura und Kanonistik prallen aufeinander
An den kirchlichen Datenschutzgerichten sind Richter*innen mit kanonistischer Qualifikation und mit Befähigung zum staatlichen Richter*innen-Amt vertreten. (Das war wohl der Kompromiss dafür, komplett auf das Erfordernis zu verzichten, Kleriker als Richter zu haben. In die Entstehung der KDSGO hat schon vor einigen Jahren die Veröffentlichung einer gutachterlichten Stellungnahme des Mainzer Kirchenrechtlers – und mittlerweile als Diakon einzigem Kleriker am Gericht – Matthias Pulte Einblick gegeben.)
Sydow konstatiert durch das Miteinander verschiedener Rechtskulturen eine »produktive Spannung«, wie man sie sonst nur an internationalen Gerichten erlebe. Die großen Differenzen lägen methodisch in den Auslegungsregeln: Während im kanonischen Recht explizit ein Primat der Wortlautauslegung festgelegt wird, ermöglicht die weltliche Rechtstradition mit Teleologie und Analogie eine freiere Auslegung. Das sei im Datenschutzgericht aber weniger relevant gewesen, da der Konsens bestehe, sich eng an der DSGVO zu orientieren. (In ihrer juristischen Dissertation hat Michaela Hermes dennoch festgestellt, dass die juristischen Auslegungsregeln über die kanonischen in der Rechtsprechung der katholischen Datenschutzgerichte dominieren.)
Laut Sydow gab es aber doch ein Feld, wo die Diskussionen heftiger waren: »Die Divergenzen bedurften aber mehrfach der Beratung innerhalb des Spruchkörpers, als es um die Interpretation des Prozessrechts und der insoweit den Gerichten zustehenden Handlungsbefugnisse ging.« Der Europarechtler macht sich dabei für die schon aus einem jüngst veröffentlichten Beschluss des DSG-DBK bekannte Position stark, dass die VwGO und nicht das kanonische Prozessrecht anzuwenden sei. Sydow kritisiert, dass die KDSGO mit sechs bis sieben Paragraphen zu Verfahrensbestimmungen sehr knapp ist und damit nicht immer den Bedürfnissen einer differenzierten Vorgehensweise gerecht wird.
Nach der Erfahrung der Gerichte würden auch die Anwält*innen, zumeist weltliche Jurist*innen, selbstverständlich erwarten, dass die VwGO anzuwenden ist. Das spreche für die Anwendung der VwGO: »Die kirchlichen Datenschutzgerichte hätten in einer solchen Frage kaum eine abweichende, aus dem CIC begründete Rechtsprechung entwickeln können, ohne auf völliges Unverständnis zu stoßen. Jedenfalls die Berechenbarkeit und damit auch die Akzeptanz des gerichtlichen Handelns hängen an der Anwendung der von den Parteien erwarteten Grundsätze.« Auch wenn man mit guten Argumenten der Einheitlichkeit der kirchlichen Rechtsordnung die Position der kirchlichen Datenschutzgerichte ablehnen kann: Im Ergebnis sorgt sie für mehr Transparenz und Rechtssicherheit.
Fazit
Der Einblick in die Arbeit der Gerichte ist sehr wertvoll. Über die hier diskutierten Aspekte hinaus erfährt man noch, dass die Gerichte vorwiegend digital arbeiten (und sich über die kircheneigene Cloud-Groupware Communicare organisieren) und wie sich die Gerichte mit Blick auf ihre Rolle positionieren. (Die allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle kirchlichen Handelns gehört nach ihrer Auffassung nicht dazu, sondern eng gefasst die Abwehr von Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht von Betroffenen auf deren Antrag – Sydow hebt dabei auf den Fall mit der widerrechtlichen Löschung ab.)
Sydow schließt mit einer deutlichen Kritik an der zersplitterten speziellen Verwaltungsgerichtslandschaft der katholischen Kirche in Deutschland, in der es neben den Datenschutzgerichten auch Arbeitsgerichte, Disziplinarkammern für die Kirchenbeamten und kirchliche Wahlprüfungskammern für die Pfarrgemeinderatswahlen, nicht aber eine allgemein Verwaltungsgerichtsbarkeit, die all diese Aufgaben übernehmen könnte: »Soweit dadurch nach und nach in immer mehr Fällen der Zugang zu einem kirchlichen Gericht eröffnet worden ist, ist dieser Entwicklungspfad überzeugend. Er schafft faktisch gewaltenteilende Strukturen in der Kirche, dient der geordneten Klärung und Entscheidung von Konflikten und trägt so zur Legitimation kirchlichen Handelns bei. Es ist aber ein institutioneller Irrweg, für jedes neue Problem eine neue Gerichtsbarkeit zu errichten. Die katholische Kirche in Deutschland hat ihn nur deshalb beschritten und mit der Schaffung der Datenschutzgerichtsbarkeit fortgesetzt, weil eine überzeugende Gesamtreform nicht gelingt.«
Gernot Sydow: Die kirchlichen Gerichte in Datenschutzsachen. Zwischenresümee einer singulären Gerichtsbarkeit am Ende der ersten Amtsperiode, in: Thomas Neumann, Peter Platen, Thomas Schüller (Hgg.): Nulla est caritas sine iustitia: Festschrift für Klaus Lüdicke zum 80. Geburstag [Beihefte zum Münsterischen Kommentar zum Codex iuris canonici 82], Essen 2023.
